Inhalt
Danzig, 1924. In der Familie Matzerath kommt ein Kind zur Welt. Vom Augenblick seiner Geburt an ist der kleine Oskar ein überaus frühreifes, hellhöriges Bürschchen. Schon in den Armen seiner Mutter beginnt der Säugling, seine Umwelt mit großer Skepsis zu betrachten. Zu seinem dritten Geburtstag bekommt Oskar eine Blechtrommel geschenkt. Und an diesem Tag beschließt er aus einer grundsätzlichen Verweigerungshaltung heraus, sein Wachstum einzustellen. Geistig und männlich entwickelt er sich sehr wohl weiter, doch seine körperliche Erscheinung schafft von diesem Tag an automatisch eine gewisse Distanz zwischen Oskar und der Welt der "Erwachsenen". Auf seiner hämmernden Blechtrommel und mit seiner Fähigkeit, Glas zu zersingen, artikuliert er seinen Protest gegen die verlogene, intrigante Welt der Erwachsenen.
Dabei hat der junge Mann, der auf seine Umwelt stets wie ein unbedarftes Kind wirkt, etwas ebenso Genialisches wie Diabolisches an sich. Er treibt seine beiden mutmaßlichen Väter in den Tod, macht Karriere als Frontkünstler für die Truppen der Nazis – und bleibt dabei doch stets höhnisch und distanziert. Erst nach Endes des Zweiten Weltkriegs beschließt er, sein Wachstum fortzusetzen, um künftig mitbestimmen zu können.

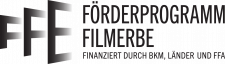
Kommentare
Sie haben diesen Film gesehen? Dann freuen wir uns auf Ihren Beitrag!
Jetzt anmelden oder registrieren und Kommentar schreiben.
Oskar bleibt ein ungewöhnliches Kind, und das nicht nur, weil er – auf eigenen Wunsch: Er arrangiert einen Treppensturz - wachstumsgehemmt ist: Er hat die Gabe, mit seiner hohen Stimme Gläser aller Art zerspringen zu lassen – wovon er stets kräftig Gebrauch macht bis hin zu veritablen Kirchenfenstern. Zwar kleinwüchsig, reift Oskar dennoch körperlich heran. Er schläft mit seiner Stiefmutter Maria, der wollüstigen Nachbarin Lina Greff sowie der kleinen Somnambulen Roswitha Raguna und sammelt auch sonst zumeist obszöne Lebenserfahrungen.
Aber auch geistig ist Oskar, der auf seine beiden väterlichen Freunde, den Liliputaner Bebra und den Spielzeughändler Markus, bauen kann, auf der Höhe seiner Zeit und gibt kluge, hintergründig-witzige Kommentare im einlullenden Märchenton von sich: „Es war einmal ein leichtgläubiges Volk, das glaubte an den Weihnachtsmann, aber der Weihnachtsmann war der Gasmann.“
Der Roman „Die Blechtrommel“ von Günter Grass war, zwanzig Jahre zuvor, zum ersten Welterfolg der deutschen Nachkriegsliteratur avanciert und trug nicht unwesentlich zum Literatur-Nobelpreis des „kaschubischen Dichters“ bei. Auch Volker Schlöndorffs kongeniale, mit einem enormen Staraufgebot verwirklichte Verfilmung wurde ein Welterfolg – und erhielt 1979 als erster bundesdeutscher Film der Nachkriegszeit die „Goldene Palme“ in Cannes. Auf die 1980 der „Oscar“ als bester fremdsprachiger Film folgte. Günter Grass selbst adelte 1979 Schlöndorffs Streifen mit folgenden Worten, denen man nichts mehr hinzufügen muss: „Ich habe für zwei Stunden meinen Roman vollkommen vergessen und nur noch diesen Film gesehen“.
Der 145-minütige Film ist zeitgleich zum Kinostart am 3. Mai 1979 parallel in drei Kinos in Berlin, Wiesbaden und Mainz „uraufgeführt“ und am 1. Mai 1984 in der ARD in einer warum auch immer nur 137-minütigen Fassung erstausgestrahlt worden. Der zum 40. „Oscar“-Jubiläum restaurierte und digitalisierte 163-minütige Director’s Cut kam am 30. August 2020 in die Kinos.
Pitt Herrmann