Ernst Neumark: Die Grundlagen des Urheberrechts an Werken und Kinematographie (1919)
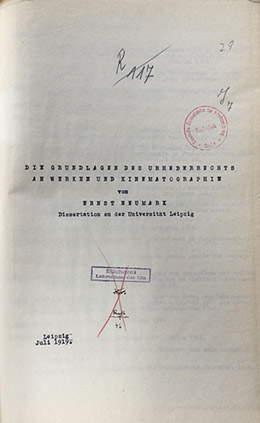 |
| Quelle: Jeanpaul Goergen |
| Buchcover |
In seiner 1919 an der Universität Leipzig vorgelegten Dissertation untersucht Ernst Neumark den urheberrechtlichen Schutz von Filmen. Er stellt zuerst die artistisch-literarischen Grundlagen der Kinematographie (Bildende Kunst, Fotografie, Drama und Pantomime) vor und untersucht dann die Kinematographie in ihrem Verhältnis zu diesen Kunstformen, um sich abschließend dem urheberrechtlichen Schutz der Filmwerke zuzuwenden.
Die Revidierte Berner Übereinkunft vom 13. November 1908 hatte erstmals umfassend "sowohl den Schutz der Werke der Literatur und Kunst gegen die Kinematographie geregelt als auch zum ersten Male die Schutzwürdigkeit der Werke der Kinematographie selbst anerkannt." (S. 5) In Deutschland fanden diese Bestimmungen zwei Jahre später Eingang in das Kunstschutzgesetz und das Literargesetz.
Neumark baut seine Überlegungen zum Urheberrecht an Filmen (er verwendet den Ausdruck "Kinematogramm") auf den bestehenden gesetzlichen Regelungen für die bildende Kunst, die Fotografie, das Drama und die Pantomime auf. Filme setzt er der Fotografie gleich, die er als eine "mechanische, durch verschiedene Maßnahmen des Fotografen zu veredelnde bildliche Wiedergabe der Wirklichkeit" (S. 37) definiert. Das Urheberrecht schütze aber nur Werke, die "aus dem Geist und der Seele des Urhebers geboren sind und diesem Gestalt und Form verdanken." Filme, "die die Wirklichkeit wiedergeben, wie sie sich ohne das Einwirken des Aufnehmenden darbietet", würden ausschließlich den Fotografieschutz genießen. (S. 38)
Im Vergleich zur Pantomime sei das Wesentliche der Kinematografie "die Handlung selbst in ihrer bunten Mannigfaltigkeit und Bewegtheit, die Handlung ohne Sinn und Nebenzweck." (S. 40) Die Regieschöpfung des Regisseurs verdiene den Schutz des Urheberrechts. Alle an der Herstellung eines Films Beteiligten – Autor, Regisseur, Kameramann, Schauspielerinnen und Schauspielerinnen, technische Gehilfen usw. – würden gemeinsam die Grundlage für dessen urheberrechtlichen Schutz schaffen, wobei aber nicht alle einen Anteil an diesem genießen würden.
Die Schwierigkeit des Gesetzgebers, das neue Medium Kinematografie sprachlich adäquat zu beschreiben, werde im Kunstschutzgesetz deutlich, das den Film "wegen der Anordnung des Bühnenvorganges oder der Verbindung der dargestellten Begebenheiten" als eine "eigentümliche Schöpfung" (S. 43) definiert. Neumark diskutiert diese Bezugnahme auf den "Bühnenvorgang" und bezieht diesen auf die Leinwand als die Bühne des Kinos. Geschützt seien sowohl Werke mit einer dramatischen Handlung als auch nichtdramatische Filme wie Animationsfilme. Grundlage des Schutzes sei die "subjektive, individuelle räumliche Gestaltung" des Werkes und sein dadurch erlangtes "besonderes Gepräge". (S. 46) Geschützt sei das erste sichtbare Produkt der Filmproduktion, nämlich das entwickelte Negativ.
Neumark sieht dokumentarische Filme, also solche, die "die Wirklichkeit selbst" zeigen, als nicht schützenswert an, da es sich dabei nicht um "dargestellte" Begebenheiten handele. (S. 47) Als Beispiel nennt er Manöveraufnahmen. An anderer Stelle führt er allerdings aus, dass schützenswerte Filme eigentlich keiner Handlung bedürfen, denn das Urheberrecht greife auch für nichtdramatische Filme, "die nur Vorgänge, Bewegung darstellen, aber keine eigentliche Handlung." (S. 49)
(Jeanpaul Goergen, Juli 2023)
Ernst Neumark: Die Grundlagen des Urheberrechts an Werken und Kinematographie. [Leipzig] 1919, 51 Seiten (= Universität Leipzig, Dissertation, Juli 1919)
Traub/Lavies: 2180