Inhalt
In Zusammenarbeit mit Studenten der Münchner Filmhochschule HFF inszenierte Wim Wenders diese Mischung aus Dokumentarfilm und Fiktion über die Filmpioniere Max, Emil und Eugen Skladanowsky. Bereits zwei Monate vor der "Filmpremiere" der Gebrüder Lumière in Paris präsentierten die Gebrüder Skladanowsky am 1. November 1895 vor 1500 Zuschauern bewegte Bilder auf ihrem "Bioscop". Ein Film über die Entstehung des Kinos, dessen "historische" Szenen mit einer Handkurbelkamera aus der Stummfilmzeit gedreht wurden.

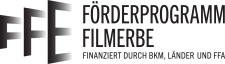
Kommentare
Sie haben diesen Film gesehen? Dann freuen wir uns auf Ihren Beitrag!
Jetzt anmelden oder registrieren und Kommentar schreiben.
Auf denen die kleine Gertrud zu sehen war, erster „Kinderstar“ sowohl im „Daumenkino“ als auch auf Filmstreifen. Und bereits zuvor häufiger (Freizeit-) Partner ihres Onkels Eugen, einem Zirkusartisten. Wim Wenders erzählt in seiner liebevollen Hommage „Die Gebrüder Skladanowsky“, einer Mischung aus Dokumentation und Fiktion (mit Nadine Büttner als Erzählerin Gertrud Skladanowsky) zum 100. Jubiläum des Kinos, die Geschichte der außerhalb Deutschlands nahezu unbekannten deutschen Kino-Pioniere.
Berlin-Pankow. Hinterhofmilieu. Max Skladanowsky bastelt an einem doppelten Schneckengang-Getriebe. „Nur ’was für Experten“, meint die Ich-Erzählerin, das naseweise Berliner Gör Gertrud, aus dem Off. Drei Männer und ein Mädchen, klar, wer daheim das Sagen hat. Gertruds Vater Max und ihr Onkel Emil sind dabei, das „Daumenkino“ weiterzuentwickeln, stets gegenwärtig, dass die neugierige Konkurrenz hinter ihren Geheimnissen her ist, weshalb Gertrud immer wieder nach „Spionen“ Ausschau halten muss.
Die Anfänge des Kinos ähneln Varieté-Vorstellungen, bei denen Gertrud zusammen mit ihrem Onkel Eugen, dem Zirkusartisten, das Finale live auf der Bühne bestreiten. Beide dienen auch als „Modelle“ für den ersten Film, den Max Skladanowsky auf einem Flachdach hoch über Pankow dreht. Es ist noch ein weiter Weg bis zur Entwicklung der Bioskop-Filmvorführmaschine. Das originale Bioskop von 1895 kann heute im Foyer des Filmmuseums Potsdam besichtigt werden.
Mit bekannten Schauspielern wie Rüdiger Vogler und Udo Kier sowie 19 Studenten und Absolventen der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen, darunter heute bekannten Namen wie die Regisseure Veit Helmer, Germán Kral, Florian Gallenberger und Matthias Lehmann, dem Cutter Markus C. Schmidt und dem Kameramann Björn Kurt, hat Wim Wenders, selbst kurz als Milchmann zu sehen, einen ersten semidokumentarischen Teil überwiegend in Schwarzweiß gedreht. Und das mit einer Handkurbelkamera aus den 1920er (Stummfilm-) Jahren.
Ihm folgt nahtlos ein zweiter Teil in Farbe, entstanden in den vier Wänden der inzwischen gestorbenen Lucie Hürtgen-Skladanowsky, der seinerzeit hochbetagten jüngeren Schwester Gertruds, die im 1907 von der Familie erworbenen Pankower Wohnhaus alle Zeitläufte überstanden hat und mit Wim Wenders in alten Kintopp-Erinnerungen schwelgt. Anrührend.
Der Hybrid aus Dokumentation und nachgestellten Szenen ist am 28. Dezember 1995 von Arte als Uraufführung erstausgestrahlt worden und am 6. Mai 1999 in die Kinos gekommen. Die in 4k restaurierte Fassung ist am 22. Juni 2024 beim int. Filmerbe-Festival in Bologna in Anwesenheit von Wim Wenders erstaufgeführt worden. Laurent Petitgand, der die Musik für zehn Filme von Wenders geschrieben hat, begleitete die Vorführung im Cinema Modernissimo live mit E-Piano, Saxophon, Mundharmonika und Gitarre.
„Tivoli“, das Pankower Kino der Gebrüder Skladanowski und damit das älteste der Republik, musste nach der Wende einem Lidl-Supermarkt weichen. Heute erinnert nur der Mosaikstreifen „1895 – 1995 Bioskop Film“ an den geschichtsträchtigen Ort, finanziert übrigens auch mit Mitteln der in München ansässigen Bioskop Film.
Pitt Herrmann