Eddie Cockrell über die Rezeption in den USA
Um die Weihnachtszeit 2005 wurden gegen Ende einer politischen Talkshow aus Washington, D.C., die Gäste nach ihrem denkwürdigsten Filmerlebnis des Jahres 2005 gefragt. Eine Journalistin antwortete sofort: "Oliver Hirschbiegels "Der Untergang", die Szene in der Magda Goebbels, nachdem ihr klar geworden war, dass ihre Kinder nicht im Nationalsozialismus aufwachen würden, diese im Schlaf vergiftet. Das Knirschen der gläsernen Kapseln zwischen den Zähnen der Kinder." Darauf folgte erst einmal Sprachlosigkeit, bis sich einer ihrer Kollegen umdrehte und sagte: "Sollen wir jetzt unsere Geschenke aufmachen?"
Ehrlicher Blick auf die Grausamkeit

Dieser spontane Dialog mag ein extremes Beispiel sein. Dennoch zeigt er deutlich die unterschiedlichen Reaktionen auf die jüngste Flut deutscher Filme über die Zeit des Nationalsozialismus, die sich mit den schwierigen Entscheidungen befassen, vor denen durchschnittliche Deutsche standen (und natürlich mit der mörderischen Politik der Machthaber). Die Tatsache, dass die Korrespondentin aus Washington den Untergang überhaupt sehen konnte, zeugt nicht nur davon, wie wirkungsvoll der Film ist, sondern auch vom Mut der internationalen Verleih- und Vertriebsfirmen. Im Internet finden sich nicht weniger als 16 Verleiher und Vertriebe für den Film, und die Liste ließe sich sicherlich noch erweitern. Das Thema verfügt also eindeutig sowohl über kulturelle Relevanz als auch über wirtschaftliches Potenzial: die beiden Faktoren also, die einem Film weltweit "Flügel verleihen". Was uns diese Filme mitbringen, mag uns aufgrund des ehrlichen Blicks auf die Grausamkeit des Nationalsozialismus entsetzlich erscheinen. Dennoch beantworten sie nicht nur Fragen, die sich junge Filmemacher wieder und wieder stellen, sondern sie dienen auch dazu, die Zuschauer auf der ganzen Welt über den grenzenlosen Fortschritt aufzuklären, den die deutsche Beschäftigung mit diesem Thema gemacht hat.

Derzeit rufen diese Werke deutliche Reaktionen sowohl von der Kritik als auch vom Publikum hervor. "Der Untergang", der die Geschichte von Hitlers letzten Tagen im Führerbunker erzählt, ist nicht nur Deutschlands offizielle Einreichung für den Oscar in der Kategorie "fremdsprachige Filme", sondern hat auf Festivals auch jede Menge Trophäen eingeheimst und in der US-Presse nachdenklich-positive Kritiken bekommen: "hoch emotional" (The Onion), "beunruhigend" (The New Republic), "bedeutend" (Salon). Und die New York Times nannte den Film "ausladend und klaustrophob". Nebenbei bemerkt: Die Einschätzung der Times, eingebettet in eine nicht durchgängig positive Kritik, konnte dem Erfolg von "Der Untergang" an den Kinokassen nichts anhaben. Ganz anders liegt der Fall bei Margarethe von Trottas "Rosenstraße": Insider gehen davon aus, dass der vernichtende Verriss der New York Times dem ansonsten durchaus positiv besprochenen Film jede Chance auf einen Erfolg außerhalb der Großstädte genommen hat.
Die Fragen der Enkelgeneration
Natürlich ist "Der Untergang" nicht der einzige jüngere deutsche Film, der sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt. Marc Rothemunds "Sophie Scholl - Die letzten Tage" ist deutlich weniger sensationslüstern, dafür aber emotional intensiver. Rothemunds Film ist (nach Michael Verhoevens "Die weiße Rose" und Percy Adlons "Fünf letzte Tage") bereits der dritte Film aus Deutschland, der sich mit der Verhaftung, Verurteilung und Hinrichtung der mittlerweile zur kulturellen Ikone gewordenen jungen Studentin befasst, die den Mut hatte, das Nazi-System zu kritisieren, und die für ihre Taten mit dem Leben bezahlte.Zwar war der Film zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels in den USA noch nicht in den Kinos gestartet, konnte aber sowohl bei großen als auch bei eher spezialisierten Filmfestivals in ganz Nordamerika sehr positive Publikumsreaktionen verbuchen. Und indem Rothemund nicht Hitler und seine Gefolgsmänner in den Mittelpunkt seiner Erzählung stellt, zeigt er das vielleicht wichtigste Dilemma seiner Generation auf: "Die Mitläufer", sagt er in einem Interview einer Branchenzeitschrift, "wollten darüber nicht mit ihren Kindern reden. Sie hatten ein sehr schlechtes Gewissen. Wir, die Generation der Enkel, haben nun angefangen, Fragen zu stellen." Es ist vielleicht aufschlussreich, dass Rothemunds Film den Untergang als offizielle deutsche Einreichung für den fremdsprachigen Oscar beerbt. (Dies ist auch der Grund, warum der Kinostart in den USA verschoben wurde.)
Abgelenkt durch die Nazisymbolik

Unter den neuen deutschen Filmerzeugnissen will einzig Dennis Gansels autobiographischer und wohlmeinender Film "Napola" (dem die amerikanische Verleihfirma Picture This Entertainment den Titel "Before the Fall" gab) nicht ganz den richtigen Ton treffen, zu sehr lässt er sich vom Fetischismus und der exzessiven Melodramatik der Nazi-Symbolik ablenken. "Napola" erzählt die autobiographische Geschichte eines jungen Mannes, der in einem nationalsozialistischen Elitegymnasium mehr und mehr in die dort verlangte Herdenmentalität abgleitet. Die New York Times nannte den Film "beeindruckend schön", Slant urteilte: "relativ beeindruckend". Die Village Voice schließlich sah ihn als "intellektuelle Durchschnittskost" und fand ihn – unvermeidlicherweise – "homoerotisch". Zugegeben, es gehört auch zu Gansels Botschaft, dass gewichste Lederstiefel einen großen Reiz ausüben: "Ich glaube, es hat ein Perspektivenwechsel stattgefunden", sagte er in einem Interview. "Viele der älteren Filme waren auf eine Art sehr politisch korrekt – man sollte immer die Perspektive der Opfer einnehmen, niemals das Verführerische zeigen. Meine Fragen hat das nie beantwortet." Auf der anderen Seite gibt es Herangehensweisen wie die des altehrwürdigen deutschen Regisseurs Volker Schlöndorff, der sich dem Thema Nationalsozialismus in den ersten vierzig Jahren seines Schaffens stets verweigert hatte, 2003 schließlich aber "Der neunte Tag" drehte. Der Film basiert lose auf den 1945 erschienen Memoiren des Abbé Jean Bernard und erzählt von einem katholischen Priester, der aus dem KZ entlassen wird und sich nun täglich bei der Gestapo melden muss. Der luxemburgische Gestapo-Chef will ihm befehlen, Einfluss auf die dortigen Kirchenführer zu nehmen, damit diese sich der Autorität der Deutschen beugen. Der Film startete in den USA zwar nur mit wenigen Kopien, die Branchenzeitschrift Variety lobte ihn allerdings als "Qualitätskino", der Boston Phoenix warnte vor seiner "trostlosen Ernsthaftigkeit", und die New York Times pries ihn als "düster und nachdenklich stimmend".
Zielstrebige Melodramatik

"Ich glaubte immer, dass sich die Konzentrationslager einer direkten Darstellung entziehen", schreibt Schlöndorff im Presseheft zu "Der neunte Tag". "Wir Deutschen können uns aber nicht mehr hinter diesem Tabu, dass diese Schrecken nicht abgebildet werden können, verstecken. Irgendwann muss man sich dem auch mal stellen, dachte ich." Es ist unfreiwillig ironisch, dass der beeindruckende deutsche Schauspieler Ulrich Matthes sowohl den unter moralischem Druck stehenden Priester in Schlöndorffs Film als auch Joseph Goebbels im "Untergang" spielt. Matthes hat sich auch in Interviews darüber geäußert, wie schwierig es war, vom Denken der einen Figur auf das der anderen umzuschalten. Weitere Filme, die sich mit bestimmten Aspekten der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen, stehen bereits in den Startlöchern: Jutta Brückners zielstrebig melodramatische "Hitlerkantate" zeigt einen zynischen Komponisten, der den offiziellen Auftrag hat, eine Symphonie für den 50. Geburtstag des Führers zu schreiben, und Hans-Christoph Blumenbergs faszinierendes TV-Doku-Drama "Die letzte Schlacht" vermischt Interviews mit Überlebenden der Schlacht um Berlin mit Spielszenen, die ihre Not zeigen.
Offene Fragen
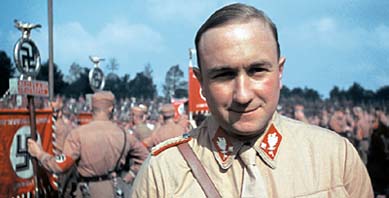
Etwas weiter hinten in der Schlange stehen die deutsch-russische Koproduktion "Halbdunkel", in der deutsche Kriegsgefangene lernen, mit den Einwohnern eines abgelegenen, verschneiten russischen Dorfes zu leben, und der Dokumentarfilm "2 oder 3 Dinge, die ich von ihm weiß", der die Kinder von Hanns Elard Ludin, Hitlers "Gesandtem" in der Slowakei während des Zweiten Weltkriegs, dabei zeigt, wie sie versuchen, mit der Tatsache zu leben, dass ihr Vater eine zentrale Rolle bei der Vernichtung der slowakischen Juden gespielt hat. (In diesem Zusammenhang muss auch daran erinnert werden, dass "Der Untergang" teilweise von dem 2002 gezeigten ärgerlich ausweichenden dokumentarischen Porträt von Traudl Junge, "Im toten Winkel - Hitlers Sekretärin", inspiriert war.)Und dann ist da noch Gordian Mauggs technisch aufregender Familienthriller "Zeppelin!", der sich zwar nicht direkt mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzt, der sich aber vor dem Hintergrund des historischen Rätsels um das Schicksal der Hindenburg mit der Frage des blinden Fanatismus beschäftigt, der die deutsche Bevölkerung dazu führte, sich der Naziideologie anzuschließen. Werden es diese oder andere deutsche Filme in das Programm von Filmfestivals und Programmkinos in den USA oder anderswo auf der Welt schaffen? Und werden sich junge deutsche Filmemacher auch weiterhin mit diesem schrecklichen und doch mehr und mehr isolierten Abschnitt der Geschichte auseinandersetzen? Darauf kann im Moment noch keine eindeutige Antwort gegeben werden, aber eines sollten Hirschbiegel, Gansel, Rothemund und ihre Mitstreiter wissen: Ihre Filme und die Fragen, die sie aufwerfen, sind für uns äußerst nützliche filmische Mitbringsel.
________________________
Eddie Cockrell ist Filmkritiker für das Branchenmagazin Variety. Wenn er nicht gerade Filme bespricht, von Filmfestivals in Europa oder Kanada berichtet, oder Filme für das jährliche Festival des neuen deutschen Films in Washington, D.C., sichtet, pendelt er zwischen einer Vorstadt von Washington in Maryland und dem australischen Sydney.