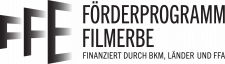Der Untergang
Frühling für Hitler
Rudolf Worschech, epd Film, Nr. 9, 02.09.2004
Das "Dritte Reich" ist ein Dauerthema im deutschen Film. Selten zuvor haben sich aber deutsche Regisseure so intensiv und so massiert mit der NS-Zeit beschäftigt wie jetzt. Am 16.9. startet Oliver Hirschbiegels "Der Untergang" (zu dem es bis Drucklegung dieses Heftes keine Pressevorführungen gab), gefolgt von Dennis Gansels Napola und Volker Schlöndorffs Der neunte Tag. Im Fernsehen liefen Jo Baiers "Stauffenberg" und davor Kai Wessels "Goebbels & Geduldig" mit Ulrich Mühe als Propagandaminister.
Als der Wiener Satiriker Karl Kraus 1933 mit der "Machtergreifung" der Nationalsozialisten und den sofort einsetzenden Willkürmaßnahmen konfrontiert wurde, schrieb er innerhalb weniger Wochen eine große satirische Polemik gegen das "Dritte Reich": "Die Dritte Walpurgisnacht". Sie versuchte, lange vor Victor Klemperer, so etwas wie die Sprachkritik der neuen braunen Herrscher. Veröffentlicht hat Kraus sie nicht, stattdessen erschien von ihm nur ein kurzes Gedicht, in dem es hieß: "Wer etwas zu sagen hat, der trete vor und schweige." Es war das Erlebnis, dass die Sprache versagt vor dem, was es zu beschreiben gilt.
Jeder Film, der sich heute mit der Zeit des "Dritten Reiches", mit dem Holocaust und dem nazistischen Unrechtsstaat beschäftigt, muss sich immer wieder erneut der Krausschen Frage stellen: wie sich einem Gegenstand nähern, der oft jedem menschlichen Empfinden spottet, der der Beschreibung Hohn spricht. In den 70 Jahren nach Kraus" Entschluss - die Polemik erschien erst postum - hat sich die Situation nicht vereinfacht. Die Symbole des "Dritten Reichs" und des Holocaust sind mittlerweile zu einer Bilderkiste geworden. Schon wenige Zeichen genügen, um einen Effekt des Wiedererkennens auszulösen, und Nazi-Symbole geistern zuhauf durch die populäre Kultur.
Wer nur ein bisschen Brainstorming betreibt, dem fallen jede Menge solcher Zitate ein. Wer sind eigentlich die Gegner von Indiana Jones? Na klar, die Nazis. Und sah nicht die Hühnerfarm in "Chicken Run" wie ein KZ aus, wo ständig der Schornstein raucht und der Stacheldraht oft ins Bild kommt? Die Nazis mit den schwarzen SS-Uniformen: ein simples Symbol für das Böse. In diesem Monat läuft, neben "Der Untergang", auch der Fantasy-Film "Hellboy" an, mit einer Nazi-Heroine im Catsuit und einem Nazi-Killer.
Das ganze Brimborium um die faszinierenden schwarzen und oft ledernen Uniformen und Mäntel hat schon Mel Brooks in seinem großartigen Film Frühling für Hitler ("The Producers") auf den Punkt gebracht. Da geht es um zwei erfolglose Musicalproduzenten, die mit dem Stück eines Altnazis, "Frühling für Hitler", Geld machen wollen: durch einen Betrug, mit einem Misserfolg. Doch das von einem schlechten Regisseur und mit einer lausigen Besetzung in Szene gesetzte Stück wird ein Bombenerfolg. In der Klimax des Films treten blonde Maiden und Jungs im schwarzen Leder auf und singen das Titellied "Springtime For Hitler and Germany, Winter for Poland and France".
Land der Väter, Land der Täter
Es gehört zu den großen Mystifikationen der letzten Jahre zu behaupten, dass die Nazi-Zeit in Deutschland zwei Jahrzehnte lang totgeschwiegen worden wäre und erst die 68er Generation die Frage nach den Tätern und Vätern gestellt habe. Im Film jedenfalls ergibt sich ein anderes Bild. Der Neue Deutsche Film hat sich eher am Rande mit der NS-Zeit beschäftigt - noch vor kurzem ist Werner Herzog mit seiner Hanussen-Verfilmung Invincible gescheitert. Sicherlich, Alexander Kluges Montagefilme drehen sich immer auch um die Untiefen deutscher Geschichte, und Volker Schlöndorff gelang mit der Blechtrommel ein epischer Film auch über den Alltag des Nazismus. Aber die eigentliche Zeit der "Bewältigung" deutscher Vergangenheit waren die fünfziger Jahre. Diskussionen über die Verbrechen der Wehrmacht kannte diese Zeit (noch) nicht, und die Filme beschreiben, wie man sich durch den Krieg organisiert hatte (die "08/15"-Trilogie), wie ein Kadett gegen seinen unfähigen Vorgesetzten revoltiert (Haie und kleine Fische), oder beschäftigen sich mit dem heroischen Widerstand. Der Politikwissenschaftler Paul Reichel rückt in seinem gerade erschienenen Buch "Erfundene Erinnerungen" die zwei Filme um das Attentat gegen Hitler im Jahre 1944, "Der 20. Juli" von Falk Harnack und G.W. Pabsts "Es geschah am 20. Juli", in den Mittelpunkt. Reichel geht davon aus, dass der Film seinen festen Platz im System der Vergangenheitsbewältigung der bundesrepublikanischen fünfziger Jahre hatte, als es darum ging, moralisch diskreditierte Personen wie NS-Funktionäre ebenso zu integrieren wie ehemals rassisch oder politisch Verfolgte oder Opfer der Vertreibung. Die bundesdeutschen Filme der fünfziger Jahre transportieren das Bild von der sauberen Wehrmacht, die Verstrickung der Wehrmacht in den nationalsozialistischen Vernichtungskrieg wird ebenso abgewehrt wie die persönliche Schuld relativiert. Filme der Defa, wie Konrad Wolfs Sterne (1959), entstanden in strikt antifaschistischem Auftrag, haben sich dieses Themas direkter angenommen.
Es gibt merkwürdige Konstanten und Analogien zwischen den Filmen der fünfziger Jahre und denen seit den Neunzigern. Die ganze Zeit hindurch konstruieren Filme bei ihren Hauptfiguren so etwas wie eine natürliche Opposition zum Regime. In den fünfziger Jahren war dafür Curd Jürgens zuständig. In Des Teufels General (1955) etwa ist sein Harras als der natürliche Antagonist des Nazi-Regimes angelegt. Ein Draufgänger und Trinker, vorlaut ("Prost mit einem leeren Glas – der Führer ist Abstinenzler"), den Frauen heftig zugetan, ein Individualist, der sich nicht in die totalitäre Gesellschaft einfügen will. Dieser Antagonismus dem System gegenüber findet sich auch in jedem neueren Militärfilm, ob er nun Stalingrad betitelt ist oder "Duel - Enemy at the Gates". Widerstand und Zivilcourage ergeben sich eher aus persönlicher Betroffenheit denn aus bewusstem Handeln. Die Frauen aus der Rosenstrasse demonstrieren – immerhin! – vor dem provisorischen Gefängnis, weil ihre jüdischen Männer dort eingesperrt sind.
Täter und Mitläufer
Eine weitere Analogie besteht in der Tendenz zum Dämonisieren: das Böse als Schicksalsmacht. Der Film der fünfziger Jahre kennt die übergroßen Nazischurken. Viktor de Kowa als Curd Jürgens" Gegenspieler in "Des Teufels General", ein aalglatter Hansjörg Felmy (in einer seiner ungewöhnlichsten Rollen) in "Schachnovelle" von Gerd Oswald, ein fanatischer, eiskalter Hannes Messemer in "Nachts, wenn der Teufel kam" von Robert Siodmak. Noch 1999 hat Roland Suso Richter in seinem "Nichts als die Wahrheit" den KZ-Arzt Josef Mengele, den "Todesengel von Auschwitz", in dieser Tradition inszeniert. Eigentlich bietet der Film eine durchaus interessante Versuchsanordnung: Was wäre, wenn Mengele nicht, wie bisher angenommen, 1979 bei einem Badeunfall in Südamerika umgekommen wäre, sondern lebte und sich, todkrank, der deutschen Justiz stellte? Und wie verhält sich ein Anwalt, der als einer der größten Mengele-Spezialisten gilt und um die Verbrechen des Arztes gegen die Menschlichkeit weiß? Richter begeht nicht den Fehler, den ehemaligen Lagerarzt etwa als Holocaust-Leugner auftreten zu lassen. "Auschwitz war ein Vernichtungslager", sagt Mengele einmal fast gelangweilt dem Staatsanwalt. Aber der Anwalt Peter Rohm (Kai Wiesinger) wie auch sein Mandant versuchen, die Verbrechen und Menschenversuche zu relativieren, aus einer Zeit zu verstehen, die schon vor 1933 den Euthanasie-Gedanken entwickelte. Richter präsentiert seinen Mengele im Gerichtssaal in einem Glaskäfig (wegen zu erwartender Attentate) wie Eichmann im Jerusalemer Prozess, und Götz George als Mengele zieht alle Register, um diesen Mann als das Böse schlechthin erscheinen zu lassen; eine altersmüde Lethargie geht von ihm aus, der nur mit säuselnder Stimme spricht. Eigentlich hätte Nichts als die Wahrheit ein interessanter Film sein können: die Konfrontation der nachgeborenen Söhne mit den Vätern, ein Film darüber, ob es angesichts des Grauens in den Lagern auch 60 Jahre danach so etwas wie eine Unbedarftheit, die "Gnade der späten Geburt", geben kann. Schon durch die Tatsache, dass Mengele seinen Prozess und damit ein Podium bekomme, habe er über "uns alle gesiegt", sagt der Staatsanwalt (Peter Roggisch) einmal. Und in Richters Film siegt das gängige Bild, die Nazi-Morbidezza (die Visconti in "Die Dämonischen" und Liliana Cavani im "Nachtportier" konsequenter inszeniert haben), über die Reflexion.
Richter ist auch daran gescheitert, die Annäherung an einen Menschen wie Mengele in das Korsett eines courtroom dramas und gängiger Spannungsdramaturgie hineinpressen zu wollen. Fast dokumentarisch hat sich auch Romuald Karmakar seinem "Himmler-Projekt" (2001), das nur auf Video/DVD herauskam, einem Täter genähert: Der Schauspieler Manfred Zapatka liest die dreistündige Geheimrede, die Heinrich Himmler am 4. Oktober 1943 vor 92 SS-Generälen im Goldenen Saal des Schlosses von Posen gehalten hat, Wort für Wort vor. In seinem nüchternen Vortrag wird, viel mehr als etwa in Richters Spielfilm, die Menschenverachtung der Nazis deutlich. Theodor Kotulla hat in seinem "Aus einem deutschen Leben" (1977) die Biographie des KZ-Kommandanten Rudolf Höß, der im Film Franz Lang heißt (so nannte sich Höß, als er untertauchte), als ein Lehrstück inszeniert, in 15 Kapiteln, von 1916, als Höß freiwillig in den Ersten Weltkrieg zieht, bis zu seiner Herrschaft über die Massenvernichtungsmaschinerie. Dabei hat es Kotulla vermieden, Auschwitz zu "inszenieren", es gibt nur wenige, meist angedeutete Szenen. Auch wenn man Kotullas kühle Inszenierung heute ein wenig belehrend finden mag, ist "Aus einem deutschen Leben" noch immer einer der besten Filme über einen faschistischen Charakter. Weil er analysiert. Weil er "deutsche" Tugenden wie Fleiß und Ordnungsliebe verantwortlich macht. Weil er zeigt, wie ein Durchschnittskleinbürger zum Massenmörder wird. Es gibt in diesem Film nicht das übliche, entlastende Gegenüber zwischen dem guten Deutschen und dem bösen Nazi, es gibt nur den Handlanger, der das Töten zu perfektionieren sucht. In Bayern wurde der Film seinerzeit nicht für den Einsatz an den Schulen zugelassen.
"Diese Mörder waren keine gemeinen Verbrecher, sie waren auch nicht geborene Sadisten oder sonst pervertiert. Im Gegenteil ... man hatte es mit normalen Menschen zu tun", hat Hannah Arendt über die Täter geschrieben. An ihnen scheint heute, fast 60 Jahre nach Kriegsende, nach dem Streit um das Holocaust-Mahnmal, der Walser-Bubis-Debatte und der Wehrmachtsausstellung, ein neues Interesse erwacht. Ebenso an denen, die Mitläufer waren und das System stützten - waren sie auch "Täter"? Istvan Szabo hat diese Frage mit "Mephisto" (1981) aufgeworfen, und sie ist, wie auch ein Blick auf Costa-Gavras" "Stellvertreter" (2003) zeigt – in dem ein bekennender Christ sich am Holocaust beteiligt - immer noch virulent. In "Taking Sides – Der Fall Furtwängler" (2003) hat Szabo selbst das Thema der Mitschuld, der moralischen Verantwortung auch desjenigen, der sich nicht die Finger schmutzig gemacht hat, revidiert. Die Befragung des Dirigenten Wilhelm Furtwängler, bravourös gespielt von Stellan Skarsgard, durch den amerikanischen Major Steve Arnold (Harvey Keitel), wirkt wie ein privates Tribunal, durchsetzt von Willkür, inszeniert von einem ehemaligen Versicherungsspezialisten, der von deutscher Kultur, wie er selbst zugibt, keine Ahnung hat. Furtwänglers Befragung, kein offizielles Gerichtsverfahren, scheint in diesem Film als die Rache der Siegermacht - und der Amerikaner ist alles andere als eine moralische Instanz. Hinzu kommt, dass der Filmarchitekt Ken Adam Bauten gefunden hat, die an die Nazi-Theatralik erinnern – nur, dass sich eben jetzt die Sieger ausgesprochen wohl darin zu fühlen scheinen: Da gibt es die Treppe des Berliner Bode-Museums auf der Museums-Insel oder das Büro, in dem Arnold thront wie früher die SS-Führer. Dass er Gestapo-Methoden verwendet, muss sich Keitels Major von seinen deutschen Mitarbeitern sagen lassen. Das Recht des Urteils nimmt sich der Offizier damit – und auch der Film.
Sympathy for the Devil?
Es hat im deutschen Film sicherlich jahrzehntelang Berührungsängste gegeben, Adolf Hitler selbst zu zeigen. Der Film der fünfziger Jahre präsentierte ihn nur in wenigen Momenten. Rainer Werner Fassbinder lässt in "Lili Marleen" (1981) die Sängerin Wilkie (Hanna Schygulla) die Treppe in der Reichskanzlei hinaufschreiten, und wenn die Flügeltüren sich öffnen, bricht ein Lichterglanz hervor – ein Moment der Kolportage, mit der der Film genau wie mit der alten Ufa-Herrlichkeit permanent spielt. In anderen Kinematographien, vornehmlich in Hollywood, gab es dieses Tabu nicht – schon Chaplins genialer "Der grosse Diktator" (1940) gibt den "Führer" der Lächerlichkeit preis.
Wenn in diesem Monat nun aber Oliver Hirschbiegels "Der Untergang" in die Kinos kommt, mit Bruno Ganz als Adolf Hitler und Juliane Köhler als Eva Braun, ist es keineswegs der erste Film im deutschsprachigen Raum mit dem "Führer" als explizitem Protagonisten und der Führungsriege des NS-Staates als principal cast. 1955 hat G.W. Pabst "Der letzte Akt" gedreht, eine österreichische Produktion, inszeniert von einem seit den Stummfilmtagen aktiven Regisseur mit einer durchaus pazifistischen Phase (Westfront 1918), der aber auch im Nazifilm arbeitete. Pabsts Film über Hitlers letzte Tage im Bunker unter der Reichskanzlei benutzt als Aufhänger die Mission eines jungen Offiziers (Oskar Werner), der von der bei Hitler versammelten Wehrmachtsführung Entsatz für seine eingekesselte Truppe verlangt. Pabst hat seinen Film als klaustrophoben Totentanz in Szene gesetzt, mit fast expressionistischem Helldunkel auf den kahlen Betonwänden des Bunkers. Der Film gesteht Hitler überhaupt keine Größe zu – ein Mann, der sich in Ritualen ergeht, der nutzlose Befehle gibt und dem auch sein lächerliches Testament überhaupt keine Tragik verleiht. Das Faszinosum der Nazi-Grandezza hat Pabst bewusst vermieden. Auch dem in dieser Zeit so oft unternommenen Versuch einer wie auch immer gearteten Rehabilitation der Wehrmacht entgeht Pabst, indem er den Generalstab als Versammlung feiger Speichellecker zeigt. In einem lesenswerten Essay über Entstehung und Wirkung dieses Films weist Michael Töteberg auf das Desinteresse des zeitgenössischen, von Verdrängung geprägten Publikums hin. Nicht einmal ein Prädikat der schon damals recht freizügigen Filmbewertungsstelle hat "Der letzte Akt" erhalten.
Pabsts Weigerung, den Nazis eine mythische Dimension (mit der sich etwa Syberberg in "Hitler – Ein Film aus Deutschland auseinander" setzt) zu geben, auch nicht in den Selbstmorden, verbindet ihn mit einem weiteren Endspiel: Christoph Schlingensiefs "100 Jahre Adolf Hitler – Die letzte Stunde im Führerbunker" (1989). Die Nazi-Clique tobt hier, übrigens auch in kräftigem Hell-Dunkel (weil alles von einem Handscheinwerfer ausgeleuchtet wurde), mit Getöse durch den Keller, ergeht sich in Intrigen und Handgreiflichkeiten. Es sind lächerliche Figuren, Udo Kier als Hitler, Dietrich Kuhlbrodt als Goebbels und Alfred Edel als Göring, die aber nie als – befreiende – Karikaturen wirken, sondern die Banalität bis zum Irrsinn exekutieren. Um die, wenn man so will, Banalität des Bösen, geht es auch Aleksandr Sokurov in seinem misslungenen "Moloch" (1999). In dem von der Welt abgeschirmten Obersalzberg wollen Hitler, sein Adjutant Bormann, Eva Braun, das Ehepaar Goebbels und ein Priester im Frühjahr 1942 ein Wochenende verbringen. Man trifft sich am Abend zum langen Mahl, dessen Gespräche fast nur um Alltäglichkeiten kreisen. Sokurov konfrontiert Monumentalität mit Trivialität – ein ermüdendes und nicht sonderlich erhellendes Prinzip. Bei Schlingensief dagegen ist die Walpurgisnacht im Führerbunker wüstes Grand Guignol – bis zum Erbrechen. Das auch der Zuschauer förmlich spürt.
Bücher zum Thema
Peter Reichel: Erfundene Erinnerung. Weltkrieg und Judenmord in Film und Theater. Carl Hanser Verlag, München 2004. 374 S., ill., 24,90 . In zwei großen Kapiteln untersucht Reichel die "Kriegsbilder der Nachkriegszeit" und "Ansichten von Auschwitz" und analysiert Filme wie Der Arzt von Stalingrad, aber auch Lili Marleen und Frank Beyers Jakob der Lügner.
Joachim Fest, Bernd Eichinger: "Der Untergang". Das Filmbuch. Rowohlt Verlag, Reinbek 2004. Ca. 460 S., ill., 10, 90 , erscheint im September. Neben Fests historischem Essay, Eichingers Drehbuch und einem Drehbericht von Christiane Peitz enthält das Buch einen Essay zu Der letzte Akt und anderen Hitler-Filmen.