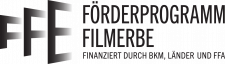Lenz
Ein bizarrer Findlingsblock
Wolfram Schütte, Frankfurter Rundschau, 10.05.1971
Nur auf einen ersten Blick gehört George Moorses jüngster Film zum sozialromantischen Heimatfilm des Augenblicks. Was ihn damit verbinden könnte: das exotische Klima seiner Trauerbilder, seine historische Miniaturarbeit und Genremalerei, die aufs äußerste gehende ästhetische Stilisierung und zuletzt der Stoff. Büchners fragmentarische Novelle "Lenz" liegt ihm zugrunde. Das trennt Moorse aber auch wieder von den anderen, die sich ihre Stoffe erst aus Akten erarbeitet haben. Sie machten Entdeckungen in der Geschichte, Moorse sucht seine Entdeckungen in einer literarischen Vorlage.
"Lenz" ist zweifellos sein bester Film bisher, der ernsthafteste, mit stärkster Identifikation von seiten des Regisseurs. "Lenz" nimmt sich ebenso fremd und bizarr aus – wenn auch weniger augenfällig – wie Werner Herzogs "Lebenszeichen". Zwei Findlingsblöcke in unserer Filmlandschaft, die man zusammendenkt, nicht allein, weil in beiden Filmen die Hauptfiguren wahnsinnig werden, der Prozeß des Verfalls von Vernunft ihr zentrales Thema ist und Natur als Gegenmacht den Menschen am Ende überwältigt Was sie über diese und zahlreiche andere verwandte Momente und Motive miteinander verbindet, läßt sich charakterisieren als eine sehr ähnliche geistige Disposition ihrer Macher. Werner Herzog hatte seine Vorlage, eine Novelle Achim von Arnims, aus dem Marseille des 19. Jahrhunderts ins Griechenland zur Zeit der deutschen Besatzung transponiert. Der Wahnsinn der Hauptfigur kristallisiert sich an der rätselhaften Sprachlosigkeit von Dingen, Geräuschen, Bewegungen und der Stille. Er bricht aus unter brütender Hitze, unter einem wolkenlosen Himmel, in einer Welt der klaren Konturen und der Schattenlosigkeit. Camus" Mythos vom Absurden ist dieser Irrationalismus näher, er kommt aus der Helle des Bewusstseins als verschwommener deutscher Innerlichkeit.
Gerade Büchner war einer der schärfsten Kritiker des Vormärz, schroff setzte er seinen Realismus gegen den Idealismus Schillers und die obskurantistische Spätromantik. In Lenz, dem Sturm-und-Drang-Dramatiker, erkannte er einen geistigen Vorläufer, einen verhinderten, erstickten Revolutionär. Büchners einzige poetische Prosaarbeit ist jedoch keine historische Novelle geworden, und politische Anspielungen fehlen ihr vollständig – im Gegensatz zu seinen drei Stücken. "Lenz" wurde zu einer ganz als Bild, Plastizität, darstellende Prosa verdichtete Reflexion. Eine Selbstbefragung: was wird aus mir, wenn ich ihn mir als Zeitgenosse vorstelle.
Lenz, vertrieben, wie der eben enttäuscht aus Darmstadt nach revolutionären Konspirationen geflohene Büchner, sucht Ruhe im Anblick der Natur, in der Weltabgeschiedenheit der elsässischen Pfarre des Freundes Oberlin. Noch glaubt er, sein poetologisches Programm des rückhaltlosen Realismus mit christlicher Religion verbinden zu können. Ruhe sucht er in den Tröstungen beider: daß die Welt so ist und immer sein wird wie die Berge, das Wasser und der Wind und daß es eine Seligkeit gibt, die über den Taumel des Lebens erhebt.
Tröstungen verlangen Opfer. Sowohl der Pantheismus, der seiner realistischen Poesie zugrunde liegt (Büchner und Lenz haben sich mit Spinoza, eingehend beschäftigt, und dessen Philosophie ist ein Ferment demokratischer Rebellion in der deutschen Literatur und Geistesgeschichte gewesen), als auch christliche Religion vergeben. Ruhe nur bei Hinnahme des Gegebenem. Was Lenz aber immer wieder "Mitleid" nennt und was ihn quält, geht übers Mitleiden hinaus, will dem Lauf der Welt ihrer Notwendigkeit, dem, So-ist-es in den Arm fallen. Ändern, tätig werden, Widerstand. Aber wo tätig werden, wo ändern, nachdem er gescheitert ist (wie Büchner, der sich desillusioniert, genau zu diesem Zeitpunkt dem Fall Lenz zuwendet)? Der Rückzug des Subjekts auf seine Innerlichkeit, sein Austritt aus der Gesellschaft, der Geschichte in die Vorgeschichte (was anders ist Oberlins weltfremde Pfarre?) und die Suche nach der verlorenen Identität mit Natur, diese Emigration aus dem tätigen Bewußtsein in ein gesuchtes untätiges, passives führt für Lenz in die Irre, ins Irresein. Das sacrificium intellectus bringt er nicht – um den Preis den er dafür zahlt: Wahnsinn.
Büchners Novelle "Lenz" ist ein Stück Chirurgie der Geistesgeschichte, beschreibt die Katastrophe eines Denkens, das sich befreit und seinen Versuchen, sich aufzugeben, widersteht und doch sich selbst gefangen hält. Was Lenz aus der Natur entgegenschreit, was ihm aus ihr an Gesichten, Bedrohungen, Ängsten aufsteigt, ist Selbstprojektion eines ziellosen, notwendig abstrakt bleibenden, in Metaphysik abgetriebenen Protestes. Erst konkrete Dialektik entkäme diesen Widersprüchen.
George Moorse hat, was Büchner als Bruchstelle seines eigenen Bewußtseins in der Figur Lenz fixierte, nicht über Büchner hinaus entwickelt (und damit als Moment der Geistes- und Gesellschaftsgeschichte historisiert), sondern viel eher romantisch zurückgebogen hinter Büchners avancierte Erkenntnis hinaus, daß bürgerliche Emanzipation nicht aus sich selbst gelingt. "Lenz", schreibt Moorse zu seinem Film, "ist ein Lied der Erde, die der Menschheit wachsende Entfremdung reflektiert in dem jungen Dichter Jakob Michael Lenz, seinem Freund, dem Pastor Oberlin und den einfachen naturbezogenen Menschen der Berge. Für mich handelt der Film von der Zeit und der Erde und davon, wie diese bestimmend für den Mittelpunkt menschlicher Beziehungen sind."
Wenn man sich auf diese Selbstdeutung einläßt, dann müßten in den zeitgenössischen Illustrationen von Amerika und der Französischen Revolution, die Moorse wie einen Schutzumschlag um seinen Film legt, nicht der Ausweg aus Lenzens Katastrophe zu sehen und gemeint sein, sondern Motive und Ankündigungen fortschreitenden Unheils. Dann werden Oberlin und seine Hinterwäldler – meist ebenso in sich ruhend und sprachlos wie die Natur dem gehetzten Lenz konfrontiert und in das warme, diffuse Licht der Zufriedenheit gehüllt – zu Bewohnern eines fernene Arkadien, eins mit Natur und sich. Dann wäre Oberlins therapeutischer Hinweis auf die Tröstungen der Religion magische Zauberformeln, und Lenz, der sich ihnen beugt, ein abgefallener Intellektueller, der sich gegen die Gesetze der Harmonie versündigt. Dann ginge Lenz an seiner Hypris zugrunde, nicht an seiner unerklärten Menschenliebe. Dann wäre „Lenz“, George Moorses Film, das Gegenteil von Büchners „Lenz“: Tragik einer unmöglichen Rückkehr zur vorbewußten Identität mit Natur, mißlungener Versuch, Naivität wiederzufinden.
Aber so eindeutig läßt sich die reaktionäre Deutung, die Moorse seinem Film beigegeben hat, in ihm nicht festmachen. Daß „Lenz“ dennoch fluoresziert, verdankt der Film vielleicht gerade Moorses sklavischer Treue zu Büchners Text. Wiewohl damit historische Differenz unterschlagen wird und sinnbildhafte Mythologie vorherrscht, durchbrechen bestimmte Motive (etwa Oberlins hilflose Religiösität) diese Mythologisierung, weil sie selbst heute historisch geworden sind.
Dennoch hat Moorse, seinem umdeutenden Konzept folgend, alles getan, Büchners Realismus zu romantisieren bis an die Schauerdramatik heran. Natur erscheint dämonisch verzerrt; das Tal mit seinen Menschen: eine Wolfsschlucht. Aber hier kommt er auch an Grenzen der Darstellungsmöglichkeiten des Films. So genau er versucht, für Büchners hitzige Nüchternheit der Sprache Bildäquivalente zu finden – was ihm an einigen Stellen überzeugend gelingt – , so weicht er doch ab von der präzisen Strenge, die Büchners "Lenz" beherrscht und untermalt den Film mit grauenhafter Orgelmusik, viragiert Einstellungen, versteigt sich manchmal zu sehr ins Expressive. Auch die Farbe ist für ihn ein Mittel, Büchners Realismus abzuschwächen und zugleich zu exaltieren ins Ästhetische. Zwar spricht Büchners Lenz vom Realismus der niederländischen Maler, der ihm als einziger lieb sei. Moorse hat das als Regieanweisung mißverstanden. Er orientiert sich, zitathaft, an Vermeer, wenn er das Idyllenglück der Dorfbewohner malt; und; Lenz wird öfter von einer goldenen Wolke Rembrandts umgeben. Ob Schwarzweiß dann nicht doch dem Original nähergekommen wäre?
Sicher rührt der große, ästhetische Reiz dieses Films, seine Faszination, aus der extremen Versenkung des Regisseurs in seine Geschichte. Über große Strecken ist "Lenz" meisterlich. Moorse sieht die Aktualität des "Falls Lenz". Der Überdruß am Denken und seinen Widersprüchen, an Gesellschaft und ihrer Gewalt, die Sehnsucht nach unverstelltem Glück, nach Intimität, nach Vergessen und das masochistische Gefühl des selbstzerstörerischen Untergangs und "Aussteigens" gehört zu den derzeitigen Stimmungen unter vielen jungen Leuten unserer Gesellschaft. In Moorses "Lenz" mag sich da mancher wiedererkennen. Auch das wäre aber nur Selbstversenkung, Passivität, „Trip“. Affirmation – so nennt man das doch wohl im Augenblick?