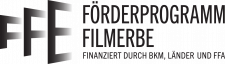Lenz
Lenz
USE, film-dienst, Nr. 17, 24.08.1971
Am 20. Jänner sei Lenz durchs Gebirge gegangen, heißt es am Anfang der pseudo-fragmentarischen kurzen Novelle "Lenz" von Georg Büchner, die über den Aufenthalt des geistesgestörten Sturm-und-Drang-Dichters im Pfarrhaus des elsässischen Philanthropen Jean-Frédéric Oberlin zu Waldersbach (Departement Bas-Rhin) berichtet. Was in der alten Bergemann-Ausgabe des Insel-Verlages gerade 26 kleinformatige Seiten füllte, hat der Drehbuchautor und Regisseur George Moorse zu einem über zweistündigen Film umgesetzt, und fast scheint es, er habe sich die Anfangsworte des Büchner-Dramas "Woyzeck" (in der Bergemann-Fassung) als Arbeitsmotto genommen: "Langsam, Woyzeck, langsam" – so langsam schreitet die bildhafte Handlung bei ihm voran. Moorse selber sieht in dieser Langsamkeit "eines der Ziele des Films, damit wir daran denken, daß unser Zeitgefühl historisch bestimmt ist".
Dieses Zitat erweist, wie sich stets für alles und jedes irgendeine hochtrabende Erklärung herbeischaffen läßt. Freilich ist seit geraumer Zeit ein bevorzugtes Thema der Literaturwissenschaft, das Problem der Langeweile bei Georg Büchner zu analysieren, doch ist es nicht damit getan, diese künstlerische Bewältigung des Langeweileproblems mittels ästhetisch oft herrlicher, aber dramaturgisch zu wenig aussagender Farbfotografie allzu direkt und unreflektiert ins Filmbild umsetzen zu wollen. Aber wie sollten diese rein innerseelischen Vorgänge umschreibende oder ausdrückende Landschaftsschilderungen Büchners auch im Film nachzugestalten sein? Bereits auf den ersten einundeinhalb Seiten erlebt er, "als jage der Wahnsinn auf Rossen hinter ihm her", wie zuerst die Natur um ihn sich in die Unendlichkeit einer apokalyptischen Todeslandschaft zu weiten scheint, wie dann ebenso plötzlich die gleiche Umwelt wieder schrumpft und die "Erde klein wurde wie ein wandelnder Stern", bis am Ende des schizophrenen Angstschubes alles wieder in den Normalzustand zurückkehrt und – "er wußte von nichts mehr".
Daß Moorse und sein Kameramann Gerard Vandenberg nicht in das öde und wilde Steintal in den Vogesen gezogen sind, wo Pfarrer Oberlin gewirkt hatte, sondern nach Unterleinleiter (bei Forchheim, Oberfranken), bleibt eine Äußerlichkeit, auch wenn die landschaftliche Struktur der Fränkischen Schweiz gewisse andere Züge aufweist als die des Elsaß. Daß Lenz eine moderne Hippie-Frisur trägt und nicht den zeitüblichen Zopf, mit dem ihn alle zeitgenössischen Konterfeis zeigen, ist schon schwerer verständlich. Und recht unsinnig, zumindest pseudokünstlerisch manieriert ist es schließlich, die Umwelt von Lenz und Oberlin in einem Bildstil zu gestalten, der – bis zu einer direkten Imitation Vermeers – den der alten holländischen Malerei aufnimmt; wenn es irgendeine malerische Entsprechung zur geistigen Welt von Lenz geben sollte, wäre diese wohl am ehesten noch bei seinem genialischen und gleichfalls schizophrenen Zeitgenossen Johann Heinrich Füsseli zu finden. Und um andererseits auch den der Literaturgeschichte unkundigen Filmbesucher über die historischen Zusammenhänge aufzuklären, muß der Film-Lenz dem Pfarrer Oberlin, der als Literaturkenner längst Lenzens Werke gelesen hat, noch seine Kurzbiografie vorerzählen, die wie aus dem Anleitungsheft zum Volkshochschulunterricht entnommen erscheint.
Trotz dieser notwendigen Einwände hat die Regiearbeit von Moorse manche Qualitäten aufzuweisen, nicht nur dank der Vandenbergschen Farbfotografie. Die drohende Natur kontrastiert mit der trauten Kerzen-Intimität des Pfarrhauses, die Wirklichkeit mit dem Artifiziellen, und dazwischen bleibt Lenz doch immer gleichermaßen gehetzt und gejagt, auf der Flucht vor sich selber. Aber wenn er bei Büchner die eigenartige Angewohnheit hat, sich in den Brunnenstein zu stürzen, kühlt er im Film nur seinen brennenden Kopf im eiskalten Winterwasser. Und wenn bei dem sonst so sangesfreudigen Büchner hier nur einmal eine Magd zwei Zeilen einer Liedstrophe zu singen hat, läßt Moorse einen alten, marionettenhaften Mann gleich sämtliche Strophen einer Art Bänkelsängerliedes mit immer den gleichen stereotypen Bewegungen und Gesten vortragen, bis das gelangweilte Publikum zu lachen beginnt. Jedoch dann packt plötzlich wieder diese karge und spröde, auf knappste Dialoge und ausschweifende Landschaftsphantasien gestellte Filmsprache von Moorse, und in den Szenen rund um das sterbende Kind und Lenzens Lazarus-Wahn scheint für Momente auch eine weitere, höhere Dimension sichtbar zu werden. Dann aber stört wieder die weder Bücher noch der historischen Figur entsprechende Zeichnung der Oberlin-Gestalt, nicht weit vom kintopphaften Klischeetyp des engherzig-verständnislosen protestantischen Pfarrers entfernt, der auch in Lenzens Krankheit nichts als die "Fügung Gottes" zu sehen vermag.
Die Stadien dieser Krankheit sind vom Schauspieler oft psychologisch glaubhaft nachgezeichnet, und bisweilen machen auch die Filmoptik und der Filmschnitt deutlich, daß der Zeitablauf für Lenz in zusammenhanglose "Augenblicke" zerfallen war. Sofern daraus die Anregung erwächst, nun auch Büchners Novelle zu lesen, darf man den Film – trotz allem – relativ sehenswert nennen.