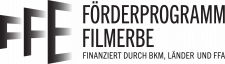Der Schuh des Manitu
Der Schuh des Manitu
Horst Peter Koll, film-dienst, Nr. 15, 17.07.2001
"Er machte einen tiefen Eindruck auf mich. Wir betrachteten einander mit einem langen, forschenden Blick, und dann glaubte ich zu bemerken, dass in seinen ernsten, dunklen Augen für einen kurzen Augenblick ein freundliches Licht aufleuchtete, wie ein Gruß..." Mit solch pathetischer Ernsthaftigkeit umschrieb Karl May (in "Winnetou I") die aufkeimende Freundschaft zwischen dem edlen Apachen-Häuptling Winnetou und Old Shatterhand, seinem weißen Blutsbruder aus Deutschland. Das deutsche Kino der 60er-Jahre fand seinen eigenen, nicht minder pompösen, zudem extrem erfolgreichen Karl-May-Touch: 2Wie ein Märchen klingt heute, was vor einem Jahrhundert noch Wirklichkeit war – bittere, harte Wirklichkeit", hieß das gefühlsbetonte Credo, mit dem "Winnetou I" (fd 12 436) eingeleitet wurde. Nun, mit der Märchenwelt war es damals schon bald vorbei, und mancher "Winnetou"-Film wurde unter dem kommerziellen Gesetz der Serialität zur unfreiwilligen Parodie seiner selbst. Nahezu 40 Jahre später genießen allenfalls noch Nostalgiker die opulenten Breitwand-Bilder ihrer Jugend, wenn Winnetou und Shatterhand in den Sonnenuntergang reiten oder Seite an Seite gegen Mörderbanden kämpfen, Ehre und Gerechtigkeit verteidigend.
Ob sie indes Michael "Bully" Herbigs stilechte Klamauk-Parodie zu würdigen wissen oder nicht doch eher als Sakrileg empfinden, sei ebenso dahingestellt wie die Frage, welcher Vertreter einer jüngeren Generation überhaupt noch die stilistische wie narrative Mechanik der Karl-May-Filme kennt, um zu verstehen, wie genau Herbig hingeschaut hat: Die unverwechselbare Farbigkeit der Rialto-Produktionen der 60er-Jahre kopiert er ebenso geschickt wie die behäbige Scope-Kamera und die zwischen Pathos und Aufgeregtheit changierende Musik; vor allem aber reproduziert er stilgerecht die gedankliche Schlichtheit, mit der damals die mangelnde naturalistische "Glaubwürdigkeit" der Bilder und Geschichten überspielt werden sollte. Doch warum das alles, wenn das Objekt der Parodie in solch weiter Ferne liegt? Wohl in erster Linie, um eine Plattform für permanent mit den Anachronismus operierende Gags, Kalauer und Sprüche zu schaffen, bei der keine Albernheit zu peinlich ist, solange sie der absolut sinnfreien Unterhaltung dient. Die Mechanik der alten Klischees wird nur decouvriert, um gnadenlos die neuen Klischees der aktuellen Gag-Kultur präsentieren können: Nichts ist blöd genug, um breit ausgewalzt zu werden, Subtilität ist Feindesland.
Bei Herbig heißen die Blutsbrüder Abahachi und Ranger, und auch wenn sie ihre seit nunmehr 16 Jahre andauernde Freundschaft des öfteren in Frage stellen und des ewigen Reitens, Anschleichens und Spurenlesens überdrüssig sind, stellen sie sich wacker der Aufgabe, den sadistischen Edelschurken Santa Maria zu jagen, der sie betrogen und ihnen die vier Teile einer Schatzkarte abspenstig gemacht hat. Die Spur führt zu einem Berg namens "Schuh des Manitu", und alles könnte in wenigen Minuten erledigt sein, hätten die Schoschonen nicht in Ermangelung eines Kriegsbeils ihren Klappstuhl ausgegraben, würde nicht Abahachis tuntiger Zwillingsbruder Winnetouch ins homoerotische Spiel kommen und hätte sich Ranger nicht in die adrette Uschi verliebt. Das führt zu zahllosen retardierenden Nonsense-Szenen und Gesprächen, ja sogar zu einigen Musicaleinlagen, bis die Freunde endlich wieder in den Sonnenuntergang reiten, auf den Lippen einen letzten bayerischen Dialog, der sie eher in die Nähe der grantelnden Polizisten-Freunde Leitmayr und Batic aus den "Tatort"-Krimis bringt als in die der archaischen Karl-May-Helden.
Unübersehbar ist, mit welch großem handwerklichen Geschick die Parodie gestrickt wurde: Das Timing ist professionell, die Dialoge sitzen, selbst die Gesangseinlagen sind nicht ohne Pfiff; und doch macht sich angesichts dieser verspottenden, verzerrenden und übertreibenden Nachahmung schnell Langeweile, ja Teilnahmslosigkeit breit, weil der Film nie ein eigenes erzählerisches Zentrum anstrebt, sondern sich lediglich als triviale Revue des Unverbindlichen gefällt. Wenn die May-Bezüge allzu dünn geraten, wird auch schon mal eine Italo-Western-Satire bemüht, doch viel zu selten scheint etwas von jener sardonischen Grimmigkeit auf, die einen Tex-Avery-Cartoon oder eine Mel-Brooks-Geschmacklosigkeit auszeichnet. Widerstandslos versandet der Film in den Untiefen boulevardesker Nichtigkeiten, die man sich eigentlich nur im Mitternachtsprogramm des Kommerzfernsehens gefallen lässt. Dies hat absolut nichts mit der ausgelassenen Rezitationsfreude jener ausufernd langen Hörfunkproduktion zu tun, die Rüdiger Hoffmann mit dem legendären Satz bereicherte: "Ja uff erstmal..."