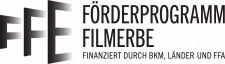Fallada - Letztes Kapitel
Anpassung oder Widerstand
(…) Erreicht: Immer stärker erweisen sich bei einigen, sich als Spitze profilierenden DEFA-Regisseuren einzelne Filme als Teil eines Werks. Zusammenhänge auch hier; Lebenslinien, existentielle Motivationen und Fragen werden deutlich, wachsen aus Absicht und Interpretation heraus, gewinnen wirkende Gestalt. Es zahlt sich aus, daß auch unter wechselnden Umständen um Kontinuität gerungen wurde. Jüngster Beleg, nach Lothar Warnekes Erfolg: Roland Gräfs "Fallada – Letztes Kapitel". Es ist Gräfs dritte Erforschung von Menschen, die von gesellschaftlichen und geschichtlichen Zwängen, Krisen, Auflösungen gefährdet, belastet, zerstört und getrieben werden. Die Befreiung von Vergangenheitsbelastung und -entfremdung war des Puppenspielers Fußberg ("Fariaho") Lebensproblem. Aber da war Gräfs Frage: "Wie notwendig ist eigentlich das, was ich mache, ich – Fußberg, ich – Gräf?" Quälende Fragen. Da liegen Nerven offen, und das spürt man. Auch die Betroffenheit in und über Friedrich Wolfs "Russenpelz" ("Das Haus am Fluß"), den Prozeß einer Desillusionierung durch Faschismus und Krieg". Aus beiden Quellen speist sich der Weg zu Fallada, dem Besessenen, Desillusionierten, Gequälten, Aufbegehrenden und Fallenden. Und weil in diesen Filmen – zunehmend! – die Menschen die Geschichten hervorbringen und tragen, entwickelt sich zweierlei: Die konkrete Geschichts- und Handlungszeit ist auch gegenwärtig, ist Teil unseres Jahrhunderts, nicht nur "damals". Vor allem, untrennbar davon: Roland Gräf ist nun ganz beim Erzählen mit dem Schauspieler, aus dem Charakter, über die Szene als Geschehen zwischen Menschen angekommen. Ein "Ankommen", das ein grenzenloses Feld eröffnet. Diese Entwicklung hin zu diesem Höhepunkt "Fallada" kann gar nicht deutlich genug gewürdigt werden, weil gerade hier – Mangel an echten Rollen und Flachheit der Schauspielerführung – ein ewiger neuralgischer Punkt unserer Filme liegt.
Und nun Fallada – Jörg Gudzuhn. Es gibt nur wenige derartige Rollenverkörperungen in DEFA-Filmen. Roland Gräfs und Helga Schütz" Respekt und Behutsamkeit gegenüber ihrem Helden treffen und vereinen sich mit Gudzuhns vibrierender Sensibilität, die zugleich Vitalität und Spiellust ist, beängstigende Identifikation und beherrschte Formung, historisierend und aus der Zeit herauswachsend (die von Kamera, Szenenbild und Kostüm als Spielraum kongenial geschaffen wird!). Das beherrscht und durchdringt das Geschehen, alle Figuren. Das Traurige ist grotesk, das Banale grausig, die Verkommenheit menschlich, das Ordentliche bedrohlich. Mehrfach war das kritische Argument zu hören, es wäre zu wenig Schrittsteller an diesem Fallada und zu wenig Geschichte in diesem Film. Aber das Universum gestalteter menschlicher Bindungen, Abgründe und Abstürze ist mehr, als alle bekannten Konkreta und Charakteristika da hätten liefern können. Die Grenzüberschreitung ist für unser künstlerisches Selbstverständnis wichtig wie eine Neu-Entdeckung.