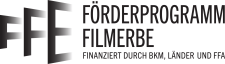Sie haben Knut
Sie haben Knut
Kritik von Kai Mihm, epd Film
Wenn man, Anfang der achtziger Jahre, noch zu jung war, um richtig "mitzumachen", hat man die anderen immer beneidet: den älteren Bruder, der an der Startbahn West Zelte aufbaute, oder den Onkel, der die gesamte Familie zum Ostermarsch bewegen wollte – das war damals eigentlich nichts Besonderes. Aber plötzlich war es vorbei: Der Ostermarsch-Onkel kaufte sich einen Mercedes, und der Startbahn-Bruder flog in den Urlaub nach Amerika. Das war Mitte der achtziger Jahre, dem coolen, glatten Hedonismus-Jahrzehnt.
Bei vielen gab es damals den Wechsel von der unbedingten Systemkritik zur unpolitischen Lebenslust. Von den ersten Symptomen dieses Übergangs erzählt Stefan Krohmers hervorragendes Kinodebüt."Sie haben Knut". Der Film spielt im Winter 1982/83 auf einer einsamen Skihütte in Tirol. Ingo will hier, in der Abgeschiedenheit, mit seiner Freundin Nadja ihre angeknackste Beziehung retten. Gleich die erste Szene, ein "Problemgespräch" zwischen den beiden Endzwanzigern, geht an die Schmerzgrenze: nicht, weil die Szene lächerlich ist, sondern weil sie mit seltener Präzision die verquaste Sprachlosigkeit solcher Situationen einfängt. Wenn man als Zuschauer lacht, dann vor allem wegen des peinlichen Wiedererkennungseffekts. Bei dieser Stimmung wirkt es direkt erlösend, als unerwarteter Besuch eintrifft: ein knappes Dutzend Freunde von Nadjas politisch aktivem Bruder Knut, die auf der Hütte ihren Skiurlaub verbringen wollen. Knut wird später nachkommen.
Während Nadja sich über die Kommunenstimmung freut, ist Ingo unendlich genervt. Er konnte Knut und dessen "Öko"-Freunde noch nie leiden. Als plötzlich die Nachricht eintrifft, Knut sei während einer Sitzblockade von der Polizei verhaftet worden, teilt sich die Gruppe in zwei Lager: Die einen wollen den Skiurlaub in ein politisches Sit-in verwandeln, während die anderen lieber die freien Tage genießen möchten. Bei diesem Konflikt treffen in der Gruppe nicht nur Lebenseinstellungen, sondern auch grundverschiedene Temperamente aufeinander. In einer Mischung aus satirischer Überspitzung und dokumentarisch anmutendem Realismus erzählen Krohmer und sein Autor Daniel Nocke von einer Phase, in der die kämpferischen Ideale der siebziger Jahre in wohlfeilen Phrasen erstarrten und sich in der Szene eine Art alternatives Spießertum zu entwickeln drohte. Andere wiederum hatten das Interesse an den alten Idealen bereits gänzlich verloren.
Man spürt die Tristesse hinter der Liedermacher-Romantik, ahnt den Selbstbetrug und die Lebenslügen hinter dem selbstgerechten Verständnis-Geschwätz und dem Betroffenheits-Gehabe – all jene typischen Symptome, die das Ende einer Ära markieren.
Die Beziehung zwischen Ingo und Nadja verliert Krohmer dabei nie aus den Augen. Sie bleibt das Herzstück des Films und bildet zugleich den dramaturgischen Rahmen für das übrige Geschehen: Wie banal kann einem "große"Politik vorkommen, wenn man selbst in einer "simplen" Beziehungskrise steckt. Bei dieser komplexen Verflechtung von politischen und privaten Haltungen, von konkret zeitbezogenen und allgemeingültig zeitlosen Konflikten kann man Krohmers leichthändige Inszenierung nur bewundern. Einfach macht er es sich jedenfalls nicht: Scheint es zunächst, als wären manche Figuren allzu simpel gestrickt, erweisen sich am Ende fast alle Charaktere als sehr komplex. Immer wieder gibt es dramaturgische Brüche, werden entscheidende Hintergrundinformationen eingestreut, die den Zuschauer zwingen, die Verhaltensweisen der Charaktere neu einzuschätzen. Das bewahrt den Film davor, zur plumpen Abrechnung mit der "altlinken Szene" zu verkommen.