Inhalt
"Majestät brauchen Sonne" – diese Phrase diente zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur dazu, die Reisefreudigkeit Kaiser Wilhelm II., des letzten deutschen Kaisers, zu erklären, sondern war gleichzeitig Maxime seiner Selbstinszenierung. Nur beim so genannten "Kaiserwetter" ging er seinen Repräsentierungspflichten nach – zur Freude der frühen Film-Berichterstatter, die seinerzeit noch die Sonne brauchten, um brauchbares Material "in den Kasten" zu bekommen. Und der Kaiser stand dem jungen Medium sehr wohlwollend gegenüber, wusste sich gekonnt in Szene zu setzen und gilt heute als der meist gefilmte Mann seiner Zeit. Peter Schamoni hat die filmischen Zeitdokumente in mühevoller Kleinarbeit aus den Archiven ausgegraben und restauriert und zeichnet mit ihnen das Bild eines Mannes, dessen Herrschaft sicher umstritten, dessen Wille zum frühen Medienstar jedoch unverkennbar ist.

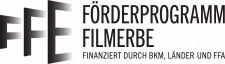
Kommentare
Sie haben diesen Film gesehen? Dann freuen wir uns auf Ihren Beitrag!
Jetzt anmelden oder registrieren und Kommentar schreiben.
Nun wissen wir also endlich, woher das geflügelte Wort vom „Kaiserwetter“ kommt: Wilhelm II. ließ sich immer nur bei schönem Wetter ablichten. Das ging so weit, dass er sogar seinen offiziellen Terminkalender nach den amtlichen Wetterprognosen ausrichtete. Naturgemäß wurden seinerzeit in erster Linie die großen repräsentativen Auftritte in Berlin gedreht, wobei das Stadtschloss immer wieder in den Mittelpunkt rückte. Aber es gibt auch, und das macht „Majestät brauchen Sonne“ - neben dem filmhistorischen Aspekt – auch zu einem wertvollen Dokument der Zeitgeschichte, Aufnahmen vom Erste Weltkrieg, von der ihm folgenden Revolution und der erzwungenen Abdankung Kaiser Wilhelms II. sowie von seinem Exil im holländischen Doorn.
Schamoni zeigt Wilhelm II. als begeisterten Jäger, als führendes Mitglied einer Männerrunde, die einmal im Jahr zu den skandinavischen Fjorden aufbricht, als begeisterten Anhänger und Förderer der Kriegsmarine – aber auch, und das ist für viele Zuschauer sicherlich neu, als verletzlichen, da „behinderten“ Repräsentanten einer dem Untergang geweihten deutschen Monarchie. Ständig war Wilhelm II. unterwegs, in seinem Reich, in Norwegen, aber auch bis hinunter nach Korfu. Er war ein vielfach interessierter Herrscher, ein begeisterter Freund der Antike, ein Bewunderer der schönen Künste und des südländisch-kontemplativen Lebensstils.
Tragisch, dass die Zeitenläufte, die er aus politischen Rücksichten, nicht aus eigenem Antrieb, kaum beeinflussen konnte, seinem Leben eine so tragische Wende gegeben haben, dass er sich keinen anderen Rat wusste, als nach der nationalsozialistischen Machtübernahme auf eine Rückkehr in Amt und Würden zu hoffen. Am Ende war Wilhelm II. ein verbitterter alter Mann, der im holländischen Doorn den Waldarbeitern assistierte.
Peter Schamoni meinte, einen klugen Griff getan zu haben, als er Mario Adorf als Sprecher des Kommentars und Otto Sander als Sprecher der Originalzitate Wilhelms II. verpflichtete. Doch die sonoren Stimmen der beiden Weltklasse-Schauspieler sind häufig nicht auseinanderzuhalten. Es ist das einzige Manko eines so überraschenden wie eindrucksvollen, immer wieder auch (unfreiwillig) komischen Films, der mit nostalgischer Verklärung aber auch gar nichts gemein hat, gerade wenn er auch die negativen, aus heutiger Sicht geradezu anrührenden Momente im persönlich-privaten Leben des Monarchen thematisiert.
Pitt Herrmann