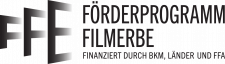Alle Zeit der Welt
Das Schweigen des Hundes
Katja Nicodemus, tip Berlin, Heft 26, 1997.
Alles ergibt sich von selbst. Gespräche über amerikanische Hummeln und Satelitenmännchen bei der Froschbalz. Der Frauenstammtisch mit tschechischen Chorälen in der Berliner Eckkneipe, ein Kleinkind, das irgendwann im Bildhintergrund ganz allein in ein Taxi steigt, oder Diskussionen über die Wahrscheinlichkeit von Flugzeugunglücken, wobei wieder im Hintergrund, ganz unvermutet ein Motorrad vom Baum fällt.
All das ergibt sich in "Alle Zeit der Welt", so, wie auch die U-Bahn ganz automatisch die Bildhorizontale durchquert, ohne große Fragen aufzuwerfen. Große Fragen stellt sich in diesem Film nur einer, der Eishockey-Torwart Anton, nachdem er im Krankenhaus einen unheilbaren Tumor in Schmetterlingsform diagnostiziert bekommen hat. Eigentlich ist es lediglich eine einzige Frage, nämlich 'Warum die Welt sich dreht, ganz allgemein und im speziellen auch ohne mich'.
Wenn überhaupt weiß die Antwort nur der Hund. Aber der sagt nichts, wedelt auch nicht einmal mit dem Schwanz, wenn er sein Piloten-Herrchen am Flughafen abholt. 'Alles geschieht', dies scheint Robert Musils Zögling Törleß in einer plötzlichen Eingebung das Geheimnis des Seins. In Matl Findels Kreuzberg-Reigen hat der Hund – aus Tibet, woher sonst – dieses Geheimnis begriffen. Nichts kann ihn erschüttern, nichts ist einer Kopfdrehung, eines Schnupperns, eines Blickes würdig. Das Tier ruht in sich, so, wie auch der Film geschieht gelassen in sich ruht, alle Welt in seltsamen Situationen zusammenführt, weder absurd, noch surreal, nur ergeben in seine wunderlichen Personen und Dialoge, die selbstverständlich auch im Bildhintergrund merkwürdige Begebenheiten auslösen können.
Alles ergibt sich, und alles hängt zusammen. Gerade wurde der australische Bilderbuchpilot Matthew von seiner Freundin verlassen, prompt begegnet er der netten Lilith. Eigentlich ist sie auf dem Weg in die Wüste Gobi, um die Paarungsgeräusche einer aussterbenden Braunbärenart zu erforschen. Direkt nach der tödlichen Diagnose läuft Anton einer Holländerin in die Arme, die aus Herbstlaub und Eisstücken vergängliche Kunstwerke nach Art des Engländers Goldsworthy arrangiert.
Den Zufall, das Schicksal, morphogenetische Felder würden andere Filme dafür verantwortlich machen, daß eines dieser Eiskunstwerke ausgerechnet die Form des Schmetterlings hat – In "Alle Zeit der Welt" ergibt es sich halt. Jeder redet hier mit Akzent, wieder so selbstverständlich, daß man sich Berlin in diesem Film irgendwann gar nicht mehr vorstellen kann ohne die arabischen Gesänge zum Minarett des Fernsehturms, ohne die venezianisch gefilmte Oberbaumbrücke, ohne die tschechischen, australischen, bayrischen, holländischen Einfärbungen und das tibetische Schweigen des Hundes. In einer derart kosmopolitischen Stadt kann der Blick in aller Ruhe ethnographisch werden. Mit kleinen Exkursen über die altmodische Hydraulik Berliner S-Bahn-Türen, mit Betrachtungen zur tschechisch-deutschen Differenz als einer Frage des Pullovertragens.
Angenehm auch Matl Findels diskreter Anarchismus: Aufgebracht hält Anton ein wütendes Plädoyer gegen Plakate, Vitrinen, Werbeflächen und andere Sichtverhinderer. Und ein rätselhafter Protest am Rande: Todesentschlossen säuft sich ein anonymer Mensch auf seinem Balkon in den Exitus. Alles ergibt sich.
So wirkt der Schluß von "Alle Zeit der Welt" wie das Ende einer unvertrauten, 100mal gehörten Geschichte, wenn eine japanische Reisegruppe im Kreuzberger Restaurant des australischen Piloten tschechische Widerstandslieder singt, dabei Raclette ißt, Wodka trinkt, mit der Holländerin über Sauerkraut, Hitler und nationale Identitäten scherzt, wenn schließlich alle von den unerträglichen Verdauungsgasen des auch in dieser Situation gelassenen tibetanischen Hundes vertrieben und von einem inzwischen recht ungehaltenen türkischen Busfahrer nach Hause kutschiert werden.