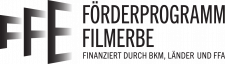Das Schweigen des Dichters
Vergebliche Nähe
Karsten Witte, Die Zeit, 10.04.1987
Weiße Fliesen warten vor einer schwarzen Tür, die sich einen Spalt breit öffnet, auf den Lichtstrahl, den sie aufnehmen wie eine Photoplatte das einfallende Licht. Die Kamera liegt tief, auf der Lauer nach dem, der mit dem Licht eintritt. Es ist ein kleiner Junge, der sich zum schlafenden Vater schleicht. Die Szene ist eine optische Geschichte und ein dramatisches Versprechen. Erst jetzt liest man den Titel des Films, der schon begonnen hat als eine Demonstration der elementaren Kinomittel und ihrer behutsamen Nutzung.
Peter Lilienthals Filme, die in den siebziger Jahren sich manches Mal wie Paniere zur Befreiungstheologie in Lateinamerika und anderswo entrollten, sind seit "Dear Mr. Wonderful" (1982) und "Das Autogramm" (1984) stiller, genauer und so vielleicht vernehmlicher geworden. Was sie an thematischer Gewichtigkeit verloren, gewannen sie an Randaufmerksamkeit. Möglicherweise findet der Regisseur zur Intensität seiner ganz frühen, heute leider verschollenen Fernsehfilme zurück. Darin vibrierte eine scheinbare Absichtslosigkeit mit visueller Spannung, die Überraschungen herstellte, die dem deutschen Film unterdessen abhanden kamen.
Lilienthal wählt mit Vorliebe Bereiche des Extraterriorialen: Chile, Nicaragua, New York und jetzt Tel Aviv. Und doch nicht Chile, Nicaragua, New York oder Tel Aviv als Schauplätze, die wie etwa für Schlöndorffs Filme einen mondänen Hintergrund abgäben. Diese Filme sind nicht bei sich selbst zu Hause. Sie buchen Verluste, Entwurzelungen, Ödland. In ihnen spiegelt sich die Geographie städtischer Steppen, die Schwundstufe der Politik. Die Malaise ihrer Figuren ist eine vergebliche Nähe.
"Der Regen machte dieses Flachland zu einem Sumpf aus Asphalt, Sand und Wasser. Tel Aviv der Regenzeit, ohne Abfluß, ohne Ausweg, Stadt der Tümpel. Und in der Ferne das Meer, dunkel, schmutzig, brüllend – als hätte sich"s vor der großen Stadt zurückgezogen und wäre nur noch Hintergrund." Ein Gelände, das keine festen Koordinaten zur Wahrnehmung hat, muß Lilienthals Phantasie entgegenkommen. Beschrieben hat es der israelische Schriftsteller Abraham B. Jeoschua in seiner Erzählung "Das wachsende Schweigen des Dichters", die Lilienthal als Ausgangspunkt für seinen neuen Film wählte.
Ein Vater erzählt von seinem Sohn. Ein Vater verschweigt dem Sohn seine Autorenschaft. Aber das Schweigen dieses Dichters wird zum Sprechenlernen des Dichtersohnes. Der Sohn, Gideon, ist ängstlich und rebellisch, fallsüchtig und retardiert. Ein Grenzfall, sagt der Vater den Lehrern in der Schule als Entschuldigung und als Motiv, diesen Grenzfall nicht abzuschieben ins Heim, in Sonderschulen. So lernt der Junge im Hause seines Vaters, innerhalb seiner Grenzen, die Artikulationshemmung zu überwinden. Er wird dem Vater Mädchen für alles und lindert derart seine Lästigkeit, um sie am Ende dadurch zu legitimieren, dass er den nicht mehr schweigenden Vater, aber noch nicht wieder schreibenden Dichter zur Vaterschaft künftiger Dichtungen treibt.
Was Freud in den Satz "Das Kind ist der Vater des Erwachsenen" zur Monade der Entwicklung faßte, mag durchaus auch Formel dieser Vater-Sohn-Dyade werden. Im gleichen Maße wie der hinfällige Vater der häuslichen Pflege durch seinen Sohn bedarf, bedarf er der stärkenden Reizung zu neuen Phantasien. Ob schließlich Vater oder Sohn, oder ob sogar das Land, in dem sie sich behaupten, ein Grenzfall sei, ist einerlei, oder besser gesagt: dreierlei und auch unteilbar.
Der Sohn hat eine Narbe auf der Stirn. Der Vater weist die Kollegen in der Zeitung auf seine eigene Narbe hin. Er zog sie sich in einer politischen Handgreiflichkeit zu, bei der er sich gegen jeden Krieg in Israel aussprach. Der Dichter nennt die eingewachsene Spur der Narbe seines Pessimismus. Das Drehbuch verstärkt diese Haltung, die in der Novelle Jeboschuas weniger zutage tritt. So wird dem Vater ein kriegsblinder Bruder beigestellt, der Körbe flicht. Ein Schwiegersohn, arbeitsloser Akademiker, will auswandern. "Jeden Abend dieser große Krieg auf dem kleinen Bildschirm", das halte er nicht aus. Meint er nur den Jom-Kippur-Krieg?
Am Krieg zerschellen auch die Fluchtpläne des Vaters, dem die Verantwortung für seinen Sohn ebenso peinlich ist wie die für sein Schreiben. Kaum ist es ihm gelungen, diesen Kindskopf von siebzehn Jahren bei der Eisenbahn unterzubringen, will er sein Schiff besteigen, das ihn an andere Ufer tragen soll. Es läuft wegen Kriegsgefahr gar nicht erst aus. Müde, aber nicht resigniert, zieht der gebeugte Dichter in ein schäbiges "Hotel Brasil" am Hafen – Lateinamerika ist für Lilienthal auch eine Befindlichkeit. Dort sucht den Vater sein von ihm nun abgelöster Sohn auf.
Als der in der Uniform der Eisenbahner in die Kammer tritt, senkt sich die Kamera von der Schulter des Sohnes auf die schreibende Hand des Vaters. Es scheint, als Schriebe diese Hand unter Aufsicht des Sohnes. Die Kamera schwenkt vom Blatt Papier aufs blanke Meer. Das Meer verwandelt sich zur Wüste. Über den Sand stürmen drei Reiter auf Araberrossen frontal auf den Zuschauer zu. Ein Sohn nimmt sich seiner Vaters an, wie sich die Phantasie eines Dichters annimmt. Und die wird so stark, daß sie Wasser berge in die Wüste und Elemente in Wünsche verrückt.
Jakov Lind, der sechzigjährige Dichter, spielt den Vater, und Len Ramras, ein zwanzigjähriger Amerikaner, seinen Sohn. Lind, in Wien geboren, überlebend im niederländischen Exil, nach dem Krieg in Israel und England, bringt in seiner massiven Präsenz auf der Leinwand die Spuren seiner Lebensgeschichte ein, doch erdrückt seine Erscheinung nie die Beiläufigkeit seiner Erfahrungen. Noch in aller Müdigkeit bleibt Linds Gesicht gespannt, nie abgekämpft. Der junge Ramras kann dagegen nur die glatten Flächen seines unbeschriebenen Gesichtes setzen, in dem sich Neugier und Verzweiflung mit schmerzender Eindeutigkeit abzeichnen.
Das Verhalten der beiden untereinander ist bestimmt von wechselnder Abwehr und Aufmerksamkeit. Schön das sprachlose Spiel, wenn der Vater schließlich zu seinem Aufbruch in ein neues Schreiben eine rote Reisetasche trägt. Denn Rot ist die Farbe, die der Sohn fetischisiert. Rote Sonnenbrillen, Tennisschuhe, Plastikkissen, Serviettenhalter, Sägen oder Köfferchen, das ist die Farbkodierung, die der Junge als Signal trägt. Über die Dinge stellt dieses seltsame Gespann einen Zusammenhang her, den die Sprache ihm nicht bietet. Denn dieses Kind ist nicht zur eigensinnig, es ist auch autistisch bis zur Rätselhaftigkeit seiner Liebe zu Hühnern.
Die Kamera stellt den Autismus ein wenig überdeutlich her. Der Junge hinter einer regenbeschlagenen Scheibe, der Junge mit der Nase auf der Tischplatte zwischen dem Modell der Statue of Liberty und einer Glaskugel, in die rote Blumen eingeschmolzen sind. Die Auflösung der Sequenzen im Zimmer des Jungen endet dreimal mit einem suchenden Schwenk auf das schmale, hohe Fenster, das in der Wand verloren und so bloß symbolistisch wirkt.
Die Figuren sind schwer greifbar. Die Kamera lässt uns auf sie blicken und entzieht uns diesen Blick. Der Kameramann Justus Pankau hält es mit extremen Brennweiten. Das wirkt, als sollte keine räumliche Dimension, sondern eine graphische Abstraktion erreicht werden. Der Zuschauer wähnt sich vergeblich in der Nähe des Geschehens.
Misslungen und deplaziert wirkt die alberne Einlage, die den Sohn des Dichters mit Gedichten des Vaters zu einem windigen Verleger schickt. Diese Verwechslung ist schlecht eingefädelt. Im Hinterzimmer einer Schneiderei, im Hawaii-Hemd vor Fußballwimpeln aus Galveston und Philadelphia, dazu in ein schmieriges Techtelmechtel mit der willigen Sekretärin verstrickt, sieht dieser Literaturverleger eher wie die Karikatur eines Porno-Produzenten aus. Dazu passt im peinlichen Sinne, was der Dichter dem Sohne endlich als Motiv seines langjährigen Schweigens verrät: "Man verlangt nicht mehr nach den Gesängen der Riesen, sondern nach dem Geschwätz der Zwerge." Das mag sein. Und wenn Zwerge sägen? Zum Glück des Film hören wir, als das lastende Schweigen gebrochen wird, keine Gigantenpoesie, sondern Elegien der Schmerzen, die einer an der Welt empfindet.
Der Vater verherrlicht nicht die Bitterkeit der Zukurzgekommenen. Auf einer kleinen improvisierten Geburtstagsfeier im "Hotel Brasil" rezitiert er keinen eigenen Text. Er greift in seinem Gedächtnis zu einem Gedicht von Michael Lermontow, dem russischen Elegiker, der zu früh verstarb, um Nachfolger des "Riesen" Puschkin zu werden. Den Text, den Jakov Lind auswählte, habe ich vergessen. Stattdessen fand ich einen anderen Text von Lermontov, der sich vom Grundgefühl des Films nicht weit entfernt: "Ich erwarte vom Leben nichts mehr, / Und um das Vergangene ist mir keineswegs leid; / Ich suche Freiheit und Ruhe! / Ich möchte mich vergessen.
Darin liegt ein Aufbruch in die Verzweiflung, eine Vergegenwärtigung der Geschichte und die gleichzeitige Lossagung von ihr. Das einstige Engagement schlittert in Extraterritoriale. Im Reich der Vernunft herrscht Regenzeit. "Tel Aviv ohne Abschluß, ohne Ausweg, Stadt der Tümpel. Und in der Ferne das Meer, dunkel, schmutzig, brüllend."
© Karsten Witte. Nachdruck und Vervielfältigung des Textes einschließlich Speicherung und Nutzung auf optischen und elektronischen Datenträgern nur mit Zustimmung des Rechtsnachfolgers.