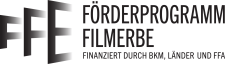40 qm Deutschland
40 m² Deutschland
Heike Mundzeck, Frankfurter Rundschau, 18.01.1986
Ein junger Mann, Türke, 23 Jahre alt, sitzt mitten auf dem Piccadilly Circus in London und starrt verwirrt und fasziniert auf das Treiben. Er spricht fast kein Wort Englisch, kennt hier niemanden und weiß nicht, was ihn erwartet. In diesem Augenblick größter Einsamkeit, abgeschnitten von jeder Kommunikation, hat er eine Vision, die ihn nicht mehr losläßt und aus der 12 Jahre später – nach abenteuerlichen Erlebnissen und bitteren Erfahrungen als Fremder in England und Deutschland – ein Kinofilm wird, für den er jetzt einen Verleih sucht.
Tevfik Başer, gelernter Fotograf, wurde im Rahmen eines Entwicklungsprojektes 1978 in seiner Heimatstadt Eskisehir in der mittleren Türkei durch deutsche Mitarbeiter von Studio Hamburg als Bühnenbildner und Ausstatter und später in der Bundesrepublik auch an der Kamera ausgebildet. Seit 1980 lebt und arbeitet er in Hamburg, vornehmlich als Kameramann und Kameraassistent.
Seit ihn die Vision von der totalen Verlorenheit in einem fremden Land packte, sammelte er alle Eindrücke darüber, studierte das Leben der türkischen Gastarbeiter in Deutschland, sprach mit vielen Frauen, fragte sie nach ihren Gefühlen, Gedanken und Wünschen und zeichnete seine eigenen Erfahrungen auf. Vor einem Jahr begann er dann mit einem Drehbuch, schrieb es fertig – und bekam wider Erwarten den Höchstbetrag von 300 000 Mark aus Mitteln der Hamburger Filmförderung. Das "Gremium von Nicht-Filmemachern", dem sein Drehbuch vorgelegen hatte, war so überzeugt davon, daß es die Summe ohne Zögern in sein Vorhaben investierte.
"40 Quadratmeter Deutschland" erzählt die Geschichte eines türkischen Paares, das in der Bundesrepublik lebt. Dursun, Gastarbeiter, etwa vierzig Jahre alt, fährt eines Tages in die Heimat, um sich dort zu verheiraten. Mit dem Vater der 18jährigen Turna wird er schnell handelseinig. Es ist ihr Wunsch, ihrem Mann in die Bundesrepublik zu folgen. Eine Hamburger Hinterhofwohnung, verwahrlost, dunkel, eng, wird ihr neues Heim – oder ihr Gefängnis.
Denn Dursun schließt seine junge Frau jeden Morgen in der Wohnung ein, wenn er zur Arbeit geht. Er ist nicht brutal oder grausam; Dursun ist Türke, konservativ, und er findet die liberalistische Lebensweise der Menschen in Deutschland abstoßend und beängstigend. Als Turna, die sich ihrer Erziehung gemäß ganz und gar abhängig fühlt von ihrem Mann, bemerkt, daß er sie einschließt, beginnt ein Prozeß des Widerstands, der ihre wütende Ohnmacht und seine verständnislose Hilflosigkeit in langen, stummen Einstellungen und kurzen Dialogen beklemmend deutlich macht.
Gefangen wie ein Tier, tagsüber immer allein, vom heimkehrenden Ehemann nach Laune benutzt für seine Lust, sprachlos in einem fremden Land, ohne jede Beziehung zum Leben um sie herum, sitzt Turna oft stundenlang am Fenster zum Hof oder läuft in der Wohnung herum, manchmal spricht sie mit ihrem Spiegelbild, manchmal spricht sie mit ihrer Puppe. Endlich wagt sie es, ihren Mann um die Erfüllung ihres größten Wunsches zu bitten: Einmal soll er sie mit hinausnehmen, nur einmal will sie die Welt hinter ihrem kargen Gefängnishof sehen. Dursun ist kein Unmensch, er tut es nicht gern, aber er verspricht ihr, sie am Sonntag auf den "Hamburger Dom" (Jahrmarkt) zu führen.
Turna ist glücklich, Turna macht sich schön dafür, so schön, wie es in ihrem kleinen Dorf in West-Anatolien bei großen Festen üblich ist. Ein Mädchen aus 1001 Nacht sitzt Dursun am sonntäglichen Frühstückstisch gegenüber. Schockiert flüchtet er. So kann er nicht mit ihr durch den lichterbunten Novembernebel einer westlich-zivilisierten Großstadt gehen! Aber das vermag er ihr auch nicht zu erklären. Den ganzen Tag lang wartet Turna vergeblich auf ihn, dann wirft sie sich weinend aufs Bett.
Dursun wünscht sich einen Sohn als Beweis seiner männlichen Potenz. Zunächst vergeblich. Ein Hodja wird bemüht. Er schreibt Turna mit Tinte eine Beschwörungsformel auf den Bauch. Dursun bezahlt ihn. Und Turna wird schwanger, endlich. Aber sechs Monate später passiert das Unfaßbare: Während eines epileptischen Anfalls stirbt Dursun nach einem schweren Sturz. Und wie um Turna auch im Tod noch daran zu hindern, die Wohnung zu verlassen, versperrt sein schwerer toter Körper die Eingangstür.
Vor Entsetzen wie gelähmt verbringt Turna die erste Nacht in eine Ecke der Wohnung gekauert. Dann versucht sie, unter Aufbietung aller Kräfte, die Leiche von der Tür wegzuziehen. Als sie es endlich geschafft hat und im Treppenhaus steht, klopft sie bei Nachbarn an die Tür, bittet eine alte Frau aufgeregt, ihr zu helfen. Aber sie wird nicht verstanden, ängstlich zieht die Frau sich zurück, andere Bewohner kommen hinzu, kopfschüttelnd und abweisend. Da geht Turna wie in Trance durch das Treppenhaus hinunter und auf die im hellen Gegenlicht liegende Haustür zu. Das ist sie, die Vision, vom Zuschauer bestürzt miterlebt: Fremd, allein, sprachlos, verwirrt in einer gleichgültigen, fast feindseligen Umgebung, hilflos, ohne Orientierung, ohne Halt und ohne Zukunft.
So besessen war Tevfik Başer all die Jahre von seinem Projekt, daß er bei den Vorbereitungen zu den Dreharbeiten nichts dem Zufall oder anderen überließ. Er selbst wählte nach wochenlangen Streifzügen durch die Stadt das Motiv aus, kümmerte sich um die Ausstattung, suchte in Deutschland und der Türkei die Schauspieler zusammen, warb und gewann Izzet Akay, den Kameramann des verstorbenen Yilmaz Güney ("Die Horde", "Die Mauer"), vertraute Claus Bantzer dieMusik an und gewann Renate Merck als Cutterin. Um so authentisch wie möglich zu sein, wird im Film nur türkisch gesprochen, längere Textpassagen sind untertitelt. Dursun wird von Yaman Okay ("Die Herde"), Turna von der türkischen, mit einem Deutschen verheirateten Jazz-Sängerin Özay Fecht (Berlin) gespielt.
Die Zwänge einer low-budget-production (Kosten rund 450 000 Mark, davon 150 000 Mark Sachleistungen und Rückstellungen) versuchten das engagierte Team und sein unermüdlicher Regisseur durch Fleiß und Kreativität einzuschränken. In 21 Tagen drehten sie 80 Minuten Film, der in sieben Wochen Schnitt und Vertonung fertiggestellt wurde.
Mit seiner Chronik der alltäglichen Ereignisse in einer türkischen Ehe auf "40 Quadratmeter Deutschland" will Tevfik Başer die Situation der Menschen "von innen heraus" zeigen. "Wenn deutsche Regisseure Filme – auch sehr gute Filme – über Türken machen, dann erzählen sie immer Geschichten drumherum, mit ihren Gefühlen, aber nicht aus der Mitte des Erlebens der Betroffenen heraus. Ich will versuchen, etwas von den Gedanken und Gefühlen der Menschen aus einer den Deutschen fremden Kultur deutlich zu machen, an der ich zwar manches zu kritisieren habe, die ich aus ihrer Tradition heraus jedoch verstehe. Ich möchte, daß die Deutschen uns kennenlernen, denn Unbekanntes macht Angst und erzeugt Haß, wie an den Ausschreitungen gegenüber den Türken zu sehen ist. Deshalb schildere ich an einem besonderen Fall die Gastarbeiterverhältnisse in der Bundesrepublik, ohne in meinem Film Wohnung und Haus auch nur ein einziges Mal zu verlassen."
Bei seiner eindringlichen Darstellung der Gefühle und inneren Erfahrungen verläßt sich Tevfik Başer nahezu ganz auf die Bildersprache. Lange Großaufnahmen von Gesichtern wechseln mit langsamen Fahrten und Schwenks durch die verschachtelte Wohnung, beschreibende Detail-Beobachtungen werden abgelöst von reglosen Totalen, bewegte Bilder der living camera von raffinierten Spiegeltricks.
So wird "40 Quadratmeter Deutschland" zu einem Film, der den Zuschauer still, aber voller innerer Spannung, ja, Dramatik, in das Geschehen hineinsaugt: Die Zeit scheint stillzustehen, endlos, das Leben fern, Geräusche täuschen, Träume ängstigen, Erinnerungen steigern nur noch das Entsetzen, verzweifelte Sehnsucht starrt ins Leere. Ein Leben in der fürchterlichen Isolation des Fremdseins mitten unter Millionen Menschen: Ein türkisches Schicksal, hier wie überall in den sogenannten Gastländern der westlichen Welt.