Fotogalerie
Alle Fotos (9)Credits
Regie
Drehbuch
Kamera
Darsteller
- Moi fa Loi, Tochter eines vornehmen Japaners
- Kin und Ken
- Kay Nordhong von der norwegischen Botschaft
- Lars Thoresen
- Minister Oydal
- Seine Gattin
- Karin Oydal, deren Nichte
- Graf Ancarcrona
Produktionsfirma
Produzent
Alle Credits
Regie
Drehbuch
Kamera
Darsteller
- Moi fa Loi, Tochter eines vornehmen Japaners
- Kin und Ken
- Kay Nordhong von der norwegischen Botschaft
- Lars Thoresen
- Minister Oydal
- Seine Gattin
- Karin Oydal, deren Nichte
- Graf Ancarcrona
Produktionsfirma
Produzent
Dreharbeiten
- Hamburg (auf dem Gelände des Tierparks Hagenbeck)
Länge:
5 Akte, 1650 m
Bild/Ton:
s/w, Stumm
Prüfung/Zensur:
Zensur (DE): 24.09.1921, B. 02828, Jugendverbot
Titel
- Schreibvariante Die Augen von Yade
- Originaltitel (DE) Die Augen von Jade
- Untertitel Unter Asiens Sonne
Fassungen
Original
Länge:
5 Akte, 1650 m
Bild/Ton:
s/w, Stumm
Prüfung/Zensur:
Zensur (DE): 24.09.1921, B. 02828, Jugendverbot
Digitalisierte Fassung
Länge:
77 min
Format:
DCP, 1:1,33
Bild/Ton:
viragiert, stumm
Prüffassung
Länge:
5 Akte
Prüfung/Zensur:
Zensur (DE): Januar 1919, 42739, Jugendverbot
Aufführung:
Uraufführung (DE): 1919
Archivfassung
Format:
35mm
Bild/Ton:
viragiert, stumm
Die Digitalisierung dieses Films wurde 2020 im Rahmen des Förderprogramm Filmerbe gefördert.
Das Förderprogramm Filmerbe (FFE) von BKM, den Ländern und FFA stellt seit dem 1. Januar 2019 für den Zeitraum von zehn Jahren jährlich bis zu 10 Millionen Euro für die Digitalisierung von Kinofilmen zur Verfügung.
Für die abendfüllenden Spiel- und Dokumentarfilme in diesem Förderprogramm stellt filmportal.de die jeweiligen Filmanfänge bereit. Eine Übersicht über alle geförderten Filme auf filmportal.de finden Sie hier.
Weitere Informationen unter www.ffa.de

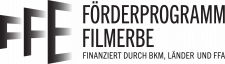
Kommentare
Sie haben diesen Film gesehen? Dann freuen wir uns auf Ihren Beitrag!
Jetzt anmelden oder registrieren und Kommentar schreiben.
Iwa Raffays Film feierte im Frühjar 1919 Premiere, kurz vor dem Ende der deutschen Kolonialherrschaft mit dem Inkrafttreten des Versailler Vertrags. Abenteuer- und Exotikfilme wie „Nahira“ (1915), „Manya, die Türkin“ (1915), „Die Augen der Mumie Ma“ (1918) oder „Die Perle des Orients“ (1921) griffen in dieser Zeit kolonial geprägte Fantasien auf und hielten Vorstellungen kultureller und moralischer Überlegenheit des Westens auf der Leinwand lebendig.
Synopsis:
In „Die Augen von Jade“ begegnet die Japanerin Moi Fa Loi dem norwegischen Diplomaten Kay Nordhong. Während ihr Vater sie aus Geldnot an den wohlhabenden Kin und Ken versprechen will, zieht Kay sie in eine Affäre – und lässt sie wieder fallen. Schwanger und mittellos findet Moi Unterschlupf bei einem Fischerehepaar. Später nimmt Kay sie auf einer Dienstreise doch mit nach Norwegen – als sein „Geheimnis“; ihr Kind soll wegen des „Nordklimas“ zurückbleiben. In Norwegen stellt Kay Karriere und bürgerliche Ehe über Moi Fa. Sie wird obdachlos, findet Arbeit als Geisha und wird schließlich nach Japan abgeschoben. Dort erfährt sie vom Tod ihres Sohnes. Jahre später, inzwischen erblindet und als Heilerin verehrt, wird sie zu dem erneut nach Japan gereisten, schwer kranken Kay gebracht. Er will sie zurück; sie lehnt ab mit den Worten: „Müd ist mein Fuß und müd ist meine Seele.“
Kurzanalyse:
Der Film entfaltet sich entlang ungleicher Machtverhältnisse, die sowohl dramaturgisch als auch ideologisch wirksam sind. Im Zentrum steht das männliche, weiße Subjekt Kay Nordhong: Seine Interessen, sein Begehren und seine Entscheidungen strukturieren die Handlung. Demgegenüber bleibt die japanische Frauenfigur auf den Status eines Objekts reduziert – Objekt des Begehrens, der Kontrolle und letztlich des Ausschlusses.
Die Inszenierung folgt kolonialen und orientalistischen Mustern. Schon die Bezeichnung „Unter Asiens Sonne“ evoziert die imperiale Losung „Ein Platz an der Sonne“, die deutsche Weltmachtansprüche im frühen 20. Jahrhundert rechtfertigte. Japan erscheint nicht als Ort mit eigenen Stimmen und Perspektiven, sondern wird zur exotischen Kulisse für westliche Projektionen: Tempel, Kimonos, Blütentänze und Trippelschritte fungieren als codierte Zeichen von Fremdheit, die zugleich ästhetisiert und erotisiert werden. Auch der Einsatz von Yellowface verweist auf rassistische Bildpolitiken der Zeit: Weiße Körper spielen „asiatisch“. Maske, Schminke, Gestik definieren „Asien“ als Kostüm.
Besonders auffällig ist die infantilisierende Sprachgestaltung: Die japanische Figur spricht von sich in der dritten Person. Zwar ist dies im Japanischen in bestimmten Kontexten nicht völlig ungewöhnlich, doch hier wird es dramaturgisch instrumentalisiert, um die Figur kindlich, naiv und „anders“ erscheinen zu lassen. Damit wird ihr das souveräne „Ich“ verweigert. Ihre Sprache wird zum Teil jener kolonial-patriarchalen Bildpolitik, die das „Fremde“ nicht als gleichwertiges Subjekt, sondern als sprachlich rückständig, emotional abhängig und kulturell untergeordnet markiert.
So offenbart der Film, dass die vermeintlich exotische Liebesgeschichte auf einer Bild- und Erzählpolitik basiert, die koloniale Hierarchien stabilisiert und die weiße männliche Perspektive zentriert.