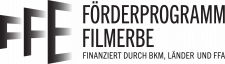Der Untergang
Der Untergang
Michael Kohler, film-dienst, Nr. 19, 16.09.04
Die Nacht ist über Deutschland herein gefallen. Eine Gruppe junger Frauen wird von Soldaten durch eine Waldlichtung in einen militärischen Fuchsbau eskortiert. Hier erwarten die zum Vorstellungsgespräch herausgeputzten Besucherinnen in angemessener Nervosität das Erscheinen ihres möglichen neuen Arbeitgebers. Der betritt schließlich den Raum, schüttelt jeder einzelnen die Hand und fragt nach ihrer Herkunft. Bei der Münchnerin Traudl Junge merkt er erfreut auf und bittet sie zum Diktat in sein Büro. Vor Aufregung macht die gelernte Sekretärin alles verkehrt, doch findet sie Verständnis auf der anderen Seite des Schreibtischs: "Jetzt machen wir das Ganze einfach noch mal." Allem Anschein nach gab es unangenehmere Chefs als Adolf Hitler.
Erstaunlich eilfertig ist "Der Untergang" zum Ereignis ausgerufen worden. Nicht nur die "Süddeutsche Zeitung" fand in seinem Sujet, den letzten Tagen Hitlers im Führerbunker, einen "Wahnsinnsstoff" und eine "Geschichte, die in ihrer Verdichtung dramatischer nicht sein könnte". Tatsächlich drängt sich nach dem oben geschilderten Prolog vieles in zweieinhalb Stunden zusammen: Hitlers wachsender Realitätsverlust, das stumme Entsetzen der Generalität, der ungebrochene Fanatismus von Joseph Goebbels; zahllose Figuren kommen und gehen, als wäre der Bunker ein narrativer Durchlauferhitzer, bis sich der Kern des Personals herausschält und mit ihm ein beklemmender Alltag unter Tage: Es ist ein stumpfes Brüten, das von Tobsuchtsanfällen unterbrochen wird, und in dem die schleichende Auflösung der allgemeinen Disziplin die Einstimmung auf den Tod ankündigt.
Doch was können jene Stunden drückender Erwartung vermitteln, das über die Sensation des noch Ungesehenen hinaus ginge? Gibt es eine Wahrheit im Zusammenbruch, die den Menschen Adolf Hitler verstehen ließe, oder einen Moment, in dem die visuelle Summe der historischen Überlieferung mehr ist als die Beredtheit ihrer Quellen? Nein, nichts davon. "Der Untergang" bietet keine neue Sicht auf Hitler und belässt ihn und alle anderen Figuren im Unschärfebereich eines nicht fassbaren Geschehens. Das hat durchaus seine Vorteile, denn so bleibt dem Zuschauer die Obszönität erspart, das Ende der nationalsozialistischen Verbrechen als persönliche Tragödie derer zu erleben, die sie verantwortet oder unterstützt haben. Was ging in Magda Goebbels vor, als sie ihre Kinder tötete, und was in Eva Braun, als sie ihrem Führer mit der Giftkapsel im Täschchen das Jawort gab? Hat Adolf Hitler am Ende um seinen zerbrochenen Traum geweint? Die Unverhältnismäßigkeit dieser Fragen gegenüber dem Leid, das der Nazismus über die Welt gebracht hat, schreit zum Himmel.
"Der Untergang" ist nicht der erste deutsche Film zum Thema, doch in der Logik seines Produzenten Bernd Eichinger mag er der erste adäquate sein. Von allen Annäherungen an die letzten Tage Adolf Hitlers entspricht der von Oliver Hirschbiegel nach Eichingers Drehbuch inszenierte Film am ehesten einem Geschichtsepos und damit der gerne gepflegten Vorstellung vom "großen2 Kino. Über das Bestreben hinaus, einen "bedeutenden" Stoff auf dem Boden des historisch Verbürgten publikumswirksam umzusetzen, steckt allerdings keine Idee in diesem Unternehmen. "Der Untergang" ist Produzentenkino der schlechteren Art: Es fehlen Handschrift und dramaturgische Stringenz, weil der Film alles auf einmal sein soll: psychologisches Kammerspiel und Tanz auf dem Vulkan, eine Studie in Klaustrophobie und eine blutige Erkundung des Häuserkriegs, historische Lektion und Erzählung aus der Hintertreppenperspektive, Ende und Neuanfang zugleich. Gerade wenn sich der Blickwinkel weitet und Eichinger versucht, Hitlers Untergang mit dem selbstverschuldeten Drama des deutschen Volkes zu verknüpfen, bleibt er im besten Fall den Klischees des Kriegsfilms treu – nicht selten umarmt er dabei den bloßen Kitsch. Themen und Motive, um einen roten Faden durchs Labyrinth zu legen, hätte es genug gegeben. Doch Eichinger mag auf nichts verzichten und macht alles nur ein bisschen, statt eines richtig.
Ein grauer Schleier intellektueller Beliebigkeit liegt über dem Film und findet im Naturalismus der Inszenierung sein ästhetisches Pendant. Wenn einzelne Momentaufnahmen ihre Wirkung gleichwohl nicht verfehlen, verstärkt dies noch den Eindruck eines Flickenteppichs. Aus Goebbels’ Rechtfertigung, warum das deutsche Volk mit seinem Führer untergehen solle, spricht die schneidende Diktion eines Heiner-Müller-Stücks, während die Unbekümmertheit, mit der Eva Braun das Ende eines Luftalarms wie eine Regenpause begrüßt, einem sarkastisch aus der Art geschlagenen Operettenfilm entlehnt sein könnte. Irgendetwas stimmt nicht, wenn selbst jene Szene unterzugehen droht, in der sich das zivile Personal von der Soldateska bußfertig im Handwerk des Freitods unterrichten lässt. Deutlicher lässt sich nicht zeigen, wie das Führerprinzip auch noch im Untergang intakt blieb. Am Ende gibt es dann doch noch eine unverhoffte Wendung ins bedeutungsschwangere Erzählen: Während in den Straßen von Berlin ein marodierendes Standgericht und ein geläuterter Hitlerjunge um die moralische Oberherrschaft ringen, hat Eichinger Hitlers Sekretärin Traudl Junge als seine Germania ausersehen. Ihre im Dokumentarfilm "Im toten Winkel – Hitlers Sekretärin" (fd 35 380) eindrucksvoll dargelegte biografische Entwicklung von der Mitläuferin zur schuldbewussten Augenzeugin stilisiert er zur Allegorie einer aus den Trümmern des Dritten Reichs gewachsenen Republik. Wäre dieses Höhlengleichnis doch ohne Außenwelt geblieben.