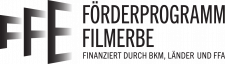Palermo oder Wolfsburg
Zum Andenken eines Engels
Karsten Witte, Die Zeit, 21.03.1980
In Sizilien sind die Berge kahl. In den Tälern südlich von Palermo verfallen die Terrassen, die einst Weinberge waren. Die Söhne der Bauern sind emigriert. Dieser Boden nährt niemanden mehr. In die Täler kippen die Palermitaner ihren Müll und zünden ihn an. Der Großgrundbesitzer, dem Enteignung wegen eines öffentlichen Bauplans droht – aber nur droht, weil er den Regierungspräsidenten kennt –, hat das Land verkauft und parzelliert. Erdhügel sollen Bauaktivitäten vortäuschen. Die Neubauruinen verfallen. Der Zusammenhang von ländlicher Schönheit, arabischer Bewässerungskunst und uralter Erfahrung der Bauern ist zerstört.
Palma di Montechiaro, ein Dorf bei Agrigent. Hier fand Werner Schroeter, begleitet .von seiner Regieassistentin und Cutterin Ursula West, den Hauptdarsteller für seinen Film "Palermo oder Wolfsburg", der auf, der Berlinale kürzlich einen Goldenen Bären erhielt. In der Osternacht habe das Filmteam, so schrieb das Giornale di Sicilia, Nicola Zarbo in der Kirche entdeckt und sei von der Ausdrucksfähigkeit des Jungen wie vom Blitz getroffen gewesen. Deutschland ist kein Fremdwort in diesem Dorf. Nicolas Vater lebt seit vierzehn Jahren als Arbeitsemigrant in Mannheim.
Zusammen mit dem sizilianischen Schriftsteller und Journalisten Giuseppe Fava schrieb Schroeter das Drehbuch. Es erzählt die fast stumme Passionsgeschichte eines jungen Sizilianers, Nicola, den der Wunsch, seiner verarmten Familie zum Kauf eines Ackers zu verhelfen, in die Fabrikarbeit nach Deutschland treibt. Über achttausend Italiener leben schon in Wolfsburg. Niemand erwartet ihn dort. Er meint, sich zu verlieben, dient seiner Freundin aber nur als Köder, die Aufmerksamkeit ihrer deutschen Freunde zurückzuerobern. Nicola ersticht die Rivalen. Freunde sagen für ihn aus. Nicola muß freigesprochen worden. Sein Geständnis, mit dem er verzweifelt seine Identität behaupten will, kommt zu spät.
Werner Schroeter, den die Kritik lange, fasziniert von seinen Acht-Millimeter-Basteleien, in den Underground abschob, zeigt hier, daß er als Handwerker auch mit dem Reichtum der Industrie eigenen Glanz zu produzieren weiß. Was jahrelang als esoterisches Schwelgen in der Materie der Hoch-Kultur gegolten hatte, entpuppt sich nun als Unterfutter einer Populär-Kultur. Die Musik, die in Schroeters frühen Filmen Gang und Gestik beherrschte, tritt nun zurück, um den szenischen Ausdruck im Umfeld zu verankern.
In dem Maße, wie Schroeters Auge sich vor der Obsession früherer Schauplätze löst, gibt sein Blick auch die Totale frei. Schien in Filmen wie "Eika Katappa" (1969) oder "Der Tod der Maria Malibran" (1971) der körperliche Ausdruck eine Übersetzung der innermusikalischen Bewegung, so tritt in den späteren Filmen seit "Regno di Napoli"/"Die neapolitanischen Geschwister" (1978) die musikalische Bewegung in den Hintergrund. Dieser Wechsel verleiht dem gestischen Ausdruck mehr Autonomie. Oder, um die veränderte Wahrnehmung zu verdeutlichen: Früher galten die Schärfeneinstellungcn der Kamera quasi dem Klangbild, heute eher dem Raumbild. Die Gestik verdoppelt die Musik nicht mehr, die Musik hingegen tritt an den Rand, um die Gestik zu kommentieren.
"Palermo oder Wolfsburg" (der in Italien mit dem sprechenden Titel "Die Höhle des Wolfs" herauskommen soll), wird von vielen Zuschauern verkürzt zitiert: "Palermo-Wolfsburg". Die Alternative im Titel fällt weg, die der Film, der gerade keine direkte Achse zwischen den Städten will, so schmerzend als Nord-Süd-Konflikt thematisiert. Von unten gesehen: als Süd-Nord-Konflikt. Die Schauplätze sind wie ein Tryptichon entfaltet: eine Stunde Exposition in Sizilien, eine Stunde Konflikt und Tat in Wolfsburg, eine Stunde Katharsis im Gerichtssaal. Die dramatische Kurve, die der Film beschreibt, beginnt bedächtig, fast dokumentarisch im ersten Teil, um sich in Wolfsburg, dem Ort der Fremderfahrung, mit zurückhaltend inszenierten Spielelementen zu verflechten und im Schlußteil steil anzuziehen in eine Gerichtsfarce, die sich immer ungehemmter der Groteske nähert.
Diese Aufteilung nach Stationen, die der Arbeitsemigrant stellvertretend für seine Landsleute erleiden muß, bestimmt nicht den Stil des Films, sondern nur die Wahrnehmung der Zuschauer. Auf italienischen Schauplätzen tolerieren wir den expressiven Ausdruck von Emotionen, um ihn auf deutscher Szene als Stilbruch abzutun. Der Prozeß, den Schroeter führt, gilt weniger einem Doppelmord, als vielmehr einer ungeklärten Vaterschaft der nationalen Identität. Italien ist für ihn dabei nur die Topographie der Sehnsucht nach dem besseren Leben, für das es einfühlsame Bilder gibt.
Menschlicher Zusammenhang, so wie er auch im Dorf Nicolas erkennbar wird, besteht im Ungetrennten, in der Öffentlichkeit von Hoffnung und Trauer, in Anteilnahme. Insofern produziert Schroeter auch hier, was ihm der Kritiker Stefano Masi für die "Neapolitanischen Geschwister" bescheinigte: einen Export-Mythos. Als Vorwurf träfe dies nur eine dokumentarische Recherche über Sizilien, nicht Schroeters kühle Vision.
Er zeigt kein Elend, das in poetischen Bildern schwelgt. Er zeigt einen Poeten, der sein Elend im Wein ersäuft, der seine Söhne nicht ernähren kann, weil der Großgrundbesitzer erpresserisch die Bodenpreise erhöht. Das Leben im Dorf ist beschränkt. Nicola schlendert mit offenen Augen durch die Enge und beschließt, sich als Arbeitskraft zu verkaufen. Deutschland, das soll das Reich der Freiheit sein, das alle Notwendigkeiten angenehm macht. In jeder Szene ist es präsent. In jedem jungen Kopf steckt dieser deutsche Traum, dessen Territorium von Emigranten dann betreten wird.
In Sizilien herrschte die Bewegtheit der Bilder, das Fließen durch ein warmes Licht und eine Polyphonie des Tons aus Klageliedern, Volksmusik, Radio und einem Dialekt, der wie ein larmoyantes Latein klingt, das durch viele Küchen, über viele Zungen lief. Nicola bringt nach Wolfsburg außer seiner Arbeitskraft seinen Blick mit, in dem sich die Bilder dieser Industriestadt kalt kadrieren. Ein Ort in der Öde, für dessen bildliche Entzifferung Nicola ein Dictionnaire gebrauchen könnte. Gut rasiert, rät ihm Giovanni, die Wirtin und einzige Freundin, solle er sich im Werk vorstellen. Er blättert im Wörterbuch, übt das Wort "Rasiermesser" und buchstabiert, auf der Suche nach Schaum, die Wörter "Crema", "Crematorio". So nah liegen, mit elliptischem Blick erfaßt, Tod und Schönheit.
Allgegenwärtig ist das Volkswagen-Emblem. Auf dem Tanzfest, der für den Mord entscheidenden Situation, ist Nicolas Kopf im Schnittpunkt der Buchstaben zu sehen, als läge er als Täter selbst im Visier eines Killers. Nicola ist ein Opfer, folgsam wie ein Lamm, wie Giovanna aussagt. Immer dichter werden während der Gerichtsverhandlung die Verweise auf das sizilianische Passionsspiel, das sich assoziativ in Nicolas Kopf schiebt. Noch die Großaufnahme der Tränen zitiert Dreyers Stummfilm "Passion der Jeanne d"Arc".
Näher aber liegt der Film in seiner Tendenz seine realistische Basis in Form einer Elevation zu verlassen, dem Werk von Pasolini. Nicola dessen Prozeß in rhythmischen Einschüben Alban Bergs Violinkonzert "Zum Andenken eines Engels" unterlegt ist, ist ein jüngerer Bruder des schönen Fremden in "Teorema", dem alle verfallen. Zerfiel bei Pasolini eine Bürgerfamilie, so wird bei Schroeter über das Medium des Täters, zum Engel stilisiert, die Strafprozeßordnung auf deren formale Einhaltung das ZDF als Co-Produzent so eifrig drang, durch die ästhetische Überformung erst recht zerrüttet. Ein Fenster weht auf und ein Radiosprecher ruft als neu-gewählten Bundeskanzler Franz Josef Strauß aus. Freispruch für den Täter, aber in welche Realität wird er entlassen?
© Karsten Witte. Nachdruck und Vervielfältigung des Textes einschließlich Speicherung und Nutzung auf optischen und elektronischen Datenträgern nur mit Zustimmung des Rechtsnachfolgers.