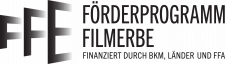Der Richter und sein Henker
Der Richter und sein Henker
Hans Gerhold, film-dienst, Nr. 11, 23.05.1978
Der Mord an dem Polizeibeamten Robert Schmied führt den ermittelnden Komissar Bärlach erneut mit seinem Jugendfreund Gastmann, einem einflußreichen Industriellen, zusammen. Dieser hatte 30 Jahre vorher in Istanbul mit Bärlach gewettet, daß er in seiner Gegenwart ein Verbrechen begehen würde, ohne daß dieser es ihm beweisen könnte. In aller Öffentlichkeit und in Bärlachs Beisein ermordete er auf der Mahmud Brücke beider Geliebte Nadine. Mit Hilfe seines Assistenten Tschanz bringt Bärlach Gastmann buchstäblich "zur Strecke", aber nun für ein Verbrechen, das dieser nicht begangen hat. Indem Bärlach sich Tschanz bedient, der der wahre Mörder Schmieds ist – er will dessen Karriere und Verlobte –, macht er sein Ziel zu Tschanz Ziel und bringt diesen überdies um die Früchte seiner Tat. In dieser ausweglosen Situation bringt sich Tschanz um.
Dieser ebenso komplizierte wie überaus geschickt konstruierte Kriminalfall nach einem Roman von Friedrich Dürrenmatt, der auch mit Maximilian Schell das Drehbuch schrieb und selbst in einer Szene des Films einen ironischen Kommentar zu seiner Rolle als Autor abgibt, dient als Vorwand für einen überaus elegischen, psychologischen Kriminalfilm, der wie seine Vorlage eine Reflexion über eine vom Zufall bestimmte Welt, den Typus des amoralischen Menschen und die Eigenart des Schweizer Wesens darstellt. Dürrenmatt zufolge ist das Geschehen für den Menschen aufgrund seiner Unvollkommenheit stets teilweise zufällig, also nicht nach Ursache und Wirkung für den menschlichen Verstand erkennbar. Gastmann zieht also aus der Wette die Konsequenz, indem er den Zufall – Nadine schwanger, ohne Geld, Selbstmord wahrscheinlich – nutzt und in der Folge unter Bärlachs Augen immer mehr Verbrechen begeht, die nicht bewiesen werden können.
Andererseits führt die entgegengesetzte Folgerung nun Bärlach dazu, Gastmann durch das Unvorhersehbare – Tschanz Mord mit Motiv – einen Mord zu "beweisen", indem er nämlich Tschanz das ausführen läßt, was das Gegenteil von dem bewirkt, was Tschanz wollte. Bärlach, der "Richter", und Tschanz, "sein Henker", stellen in dieser symbolhaften Konstellation als Instanz und Werkzeug die Ergänzung und gleichzeitig die legalen Gegenpole zu Gastmanns amoralischem Übermenschen dar, der in blasphemischer Weise – "nur sein (Gottes) bescheidener Diener", sagt er einmal von sich – auftritt und dank seiner Macht beinahe der heimliche Regent eines ganzen Staates ist. Der Waffenhändler Gastmann wird von Schell dabei in ähnlicher Weise dämonisiert wie etwa Orson Welles in Carol Reeds "Der dritte Mann", der aber im Gegensatz zu Gastmann noch sympathische Züge hatte. Diese mythische Überhöhung des "Bösen" korrespondiert mit der des "Guten", des von Magengeschwüren zerfressenen Kommissars, der trotz aller Nachteile den Sieg davonträgt. Das David-und-Goliath-Motiv aus dem Alten Testament – Macht, Einfluß und Gefährlichkeit sind eindeutig auf Gastmanns Seite, Bärlach hat dem nur seine List und Beharrlichkeit entgegenzusetzen – durchzieht als Leitmotiv den Film. Im Grunde aber hat Bärlach seinem toten Opfer nicht viel voraus, denn er hat nur noch ein Jahr zu leben. An dieser Stelle verschiebt sich der Tenor des Films ein wenig gegenüber dem des Romans, der resignativ endet, wohingegen Bärlach im Film sein letztes Jahr eindeutig bejaht.
Dürrenmatts als "literarischer, christlicher Anti-Kriminalroman" bezeichnete Vorlage ist in einigen Punkten im Film geändert worden. Neben einer Zeitverschiebung von der Nachkriegszeit in die Gegenwart und der Geschehnisse in Istanbul bereits zu Beginn des Films anstelle einer Rückblende in der Mitte der Handlung wird der Nationalrat von Schwendi, Gastmanns Anwalt, im Film ermordet, was Gelegenheit für einen ebenso spektakulären wie überflüssigen Mord in der Ankunftshalle des Flughafens von Bern ergibt. Die wichtigste und dem Film zum Vorteil gereichende Änderung liegt in der Aufwertung der Anna, der Verlobten des ermordeten Schmied, die im Roman fast unberücksichtigt bleibt, im Film aber als außerhalb des Spiels von Bärlach, Gastmann und Tschanz stehende Beobachterin entscheidende Konturen gewinnt – z. B. ihr Verhältnis zum Kommissar – und von Jacqueline Bisset sehr konzentriert gespielt wird. Von den übrigen durchweg hervorragenden Schauspielern sei besonders der amerikanische Regisseur Martin Ritt genannt, der im Laufe des Films in seiner Bärbeißigkeit und Verletzlichkeit eine ganze Kollektion Schweizer Eigenarten vermittelt, die einmal als "kalt, bieder und verschlafen" bezeichnet werden – nur zum Teil zu Unrecht.
Die formale Gestaltung beschränkt sich, des psychologischen Charakters der Geschichte gemäß, auf Großaufnahmen und komplizierte Kamerabewegungen (Mordversuch an Bärlach). Der rein gedanklichen Konstruktion der Handlung wegen wird viel mit Weichzeichnern und Nebeln gearbeitet, die eine Atmosphäre des Surrealen und Mystischen schaffen, die mit symbolischen Bildern – ein Leopard in einer leeren Halle als visuelles Äquivalent zu Gastmanns Charakter und ein Violinist, der unter einem Baum auf einer herbstlichen Wiese zum bevorstehenden Tod von Gastmann aufspielt – unterlegt ist. Neben einigen gelungenen Landschaftsimpressionen aus der Schweiz sei besonders auf das unaufdringliche und sehr geschickt variierte musikalische Leitmotiv von Ennio Morricone hingewiesen, das die elegische und endzeitliche Stimmung des Films unterstreicht.