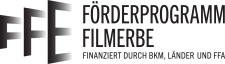Kroko
Kroko
Rudolf Worschech, epd Film, Nr.3, 02.03.2004
Manchmal drängt sich der Eindruck auf, dass der gegenwärtige deutsche Film seine besten Geschichten bei Jugendlichen und Heranwachsenden findet. Vielleicht, weil die Filmemacher sich da am besten auskennen. Der dffb-Absolventin Sylke Enders ist mit ihrem "Kroko" jedenfalls ein beachtliches Debüt gelungen: ein Film um eine 16-Jährige, die überall aneckt und deren Geschichte man schon zu Dutzend Malen im Fernsehen oder im Kino gesehen haben könnte. Aber wenn der Film sich entwickelt, merkt man, wie wenig Enders, die den Film nach ihrem gleichnamigen Kurzfilm für die SFB-Sendereihe "Boomtown" entwickelte, den vorgezeichneten Bahnen folgt.
Kroko lebt im Berliner Wedding – oder besser: auf dessen Straßen – geht nicht mehr zur Schule, zu irgendeiner Arbeit aber auch nicht, sie führt eine kleine Frauen-Gang an und kommt nach Hause, wann sie will. Kroko ist blond, immer gelangweilt und eisig. Cool wäre zu freundlich gesagt. Emotionale Blockade, würde wahrscheinlich ein Therapeut diagnostizieren, aber den gibt es zum Glück in diesem Film nicht.
Kroko wird gespielt von Franziska Jünger, die keine professionelle Schauspielerin ist. Man braucht seine Zeit, sich daran zu gewöhnen, aber dann fasziniert gerade ihre spröde Unnahbarkeit, die immer auch etwas von Krokos Unsicherheit und Hilflosigkeit verrät. Kroko ist keine spätpubertäre Verweigerin, ganz im Gegenteil: Dem Konsum ist sie und ihre Clique durchaus aufgeschlossen. Einmal, in der Nacht, setzt sie sich ans Steuer eines fremden Autos und fährt einen Passanten um. Das bringt ihr ein paar Wochen Sozialdienst in einer betreuten Behinderten-WG ein, bei den "Spastis", wie ihr Freund (Hinnerk Schönemann) meint. Ihr gelangweilter Habitus wird zu ihrer Abwehr, als sie der Betreuer, ein "Birkenstock-Kiffer", wie sie findet, den Bewohnern vorstellt und sie in den Alltag integrieren will.
Präzise zeichnet Enders Krokos Welt – ohne je zu überzeichnen. Die Mutter ist sichtlich überfordert mit ihrer Tochter – aber wer wäre das nicht? Der Film bemüht auch keine Erklärungen für Krokos Verhalten, er will auch auf kein Lamento über die Perspektivlosigkeit einer Generation hinaus. Ihm genügt das Zeigen: wie ihr Freund sie schlägt oder sie sogar mit ihrer Schwester stehlen geht.
Kroko freundet sich mit einem der Bewohner an, dem Rollstuhlfahrer Thomas. Aber auch anfreunden wäre fast schon zuviel gesagt: Sie spricht eben mit ihm. Sie begleitet die Gruppe auf einem Wochendausflug, gibt Thomas Alkohol zu trinken, fährt mit ihm eine Skaterbahn hinunter. Die Folge: Er bekommt einen Anfall, und Kroko sucht das Weite.
Enders hat um ihre Protagonistin ein dichtes Beziehungsgeflecht gebaut: die Clique, in der sie langsam ihren Platz verliert, ihr Freund, der auch kein rechter Trost ist, ihre Mutter, die sich einen neuen Freund gesucht hat, der Sozialarbeiter, emotional auch eher abgehärtet. Es gibt für sie keine Haltepunkte oder Anlaufstellen, die sie ja sowieso nicht gerade sucht.
Am Ende fährt Kroko mit dem Dicken aus ihrer Clique auf dem Moped weg. Sie war mit den "Spastis" auf dem Rummel. Etwas ist anders geworden in ihrem Leben. Aber was genau, das wissen wir nicht. Und Kroko wahrscheinlich auch nicht. Noch nicht.