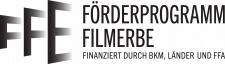Es herrscht Ruhe im Land
Wer beherrscht die Ruhe?
Karsten Witte, Frankfurter Rundschau, 05.03.1976
Es gibt Filmtitel wie "Die Erde bebt", "Nicht versöhnt" oder "Falsche Bewegung", die uns so angehen, daß sie aus dem Vorspann aussteigen und sich in unserem Kopf einnisten. Sie betreffen unsere Lage, die sich fern vor Augen bot, so schlagend, daß wir mit dem Augenschein nun über den Begriff verfügen. Eine Verlautbarung wie "Es herrscht Ruhe im Land" schürt unsere Neugier, wer die Ruhe beherrscht, in der Gewißheit, daß jenes Land so fern von uns nicht liegen kann: wo jene Ruhe kein freies Schweigen im Walde, sondern den Befehl zur Unterdrückung öffentlicher Rede meint, die von der herrschenden abweicht.
Lilienthals Film zeigt am Beispiel einer kleinen Stadt in einem lateinamerikanischen Land weniger die Bedingungen des gewöhnlichen Faschismus als die Bedingungen, die ihn durch Gegenwehr zu überwinden helfen. Aber nicht als strategischen Widerstand, sondern als spontan entstandene und ausgehaltene Gegenwehr wird dieser Kampf gezeigt. Klar, daß er zu spät kommt, wichtig: daß er aufkommt.
Ein junger Postangestellter beobachtet am Flughafen, wie eine Gruppe politischer Häftlinge wie Frachtgut verladen und ins Stadtgefängnis von Las Piedras abgeschoben wird. Zusammen mit einer Ärztin, einem Mechaniker, einer Lehrerin organisiert er ein Bürgerkomitee, das sich für die Gefangenen einsetzt. Die Bevölkerung erfährt von Folterungen. Sie unterstützt den Widerstand mit Kleidern, Naturalien. Ein Jongleur schmuggelt Waffen ein. Nicht alle schließen sich offen an. Die Angst wird zur Legislative der Ruhe, die herrscht. Aber der Bäcker, die Ärztin tun, was sie können. Die Revolte gelingt, ein Teil der Häftlinge bricht aus, der Rest wird überwältigt, das Kriegsrecht ausgerufen, die Häftlinge dem Militär überantwortet und bestialisch niedergemetzelt. Die ganze Stadt wird durchwühlt, so lange, bis sie entvölkert und geschlossen im Stadion inhaftiert ist.
Nur der alte Mann (Charles Vanel) scheint verschont. Er tritt vors Stadion, schreit "Faschisten! Verbrecher!" und wird eingelassen. Die Gegenwehr erlischt, aber die Gegengewalt ersann durch solchen Protest neue Formen, die Zerschlagung aufzuheben. Die ganze Stadt ist wie auf einer Verbannungsinsel, Handel und Transport ist unterbunden: wen soll das Militär regieren, wenn es die Abschaffung des Volks verwaltet?
Der Film ist eine Bilderkette von Verfügungsgesten, die sprachlich nur passiv zu spiegeln sind. Faschismus, das ist auch Ausdruck der Verfügungsgewalt über Körper, die hier unentwegt geschoben, geschlagen und geschunden werden. Aber nicht in einem Höllenkreis einer ritualisiert erdachten Gewaltphilosophie, sondern einer konkreten politischen Situation. Die Ruhe, die da herrscht, ist Unterdrückung, das Land, wo die Ruhe regiert, Chile, Argentinien, Uruguay ..., wo immer das Militär die Exekutive als gewaltvollstreckende Macht handhabt.
Mit allen Mitteln hebt sich dieser Film von Polit-Thrillern im Stil eines Costa-Gavras ab, der stets den individuellen Helden an die Rampe schiebt. Ein politischer Film in jenem Genre ist immer über jemanden, der, womöglich als Märtyrer, Politik macht. Lilienthal macht einen Film über unpolitische Leute, seine Helden sind das Volk, das erst mühsam seine Lage begreift und sich zur Wehr setzt. Dramaturgisch drückt sich das in einer Gleichgewichtigkeit der Figuren aus, die nicht als Handlanger für einen Helden verheizt werden, sondern, unter dem Druck der Gewalt, lernen, einer für den anderen einzustehen. Solidarität ist hier kein spektakulärer Schlag, sondern die stillen, ungefragten Gesten der Selbstverständlichkeit, die Boden gewinnt, auch wo der Feind das Haus besetzt. Ein Sergeant zum Beispiel muß seine alte Lehrerin verhaften und glaubt, sich privat, das heißt höflich verhalten zu können, bis ihm die Lehrerin seine Lage beibringt.
Der Kameramann Robby Müller, der fast ausschließlich für Filme von Wenders gearbeitet hat, verwendet hier durchgängig extreme Brennweiten. Das läßt das Bild sehr flächig erscheinen, die Dimension scheint aus dem Raum wie weggedrückt. Dazu ist die Kopie aufgeblasen, was die Gesichter grobkörnig erscheinen läßt – alles Mittel des dokumentarischen Stils, der mit versteckter Kamera auf der Straße arbeitet, die er nicht inszenieren will. Hinzu kommt einkopiertes Wochenschaumaterial aus Argentinien, aus denen die Gesichter der herrschenden Clique wie Steckbrieffotos, grob gerastert, auftauschen. Der Film behauptet eine Fiktionalität, die er in Wirklichkeit nicht besitzt, aber in unserem Verteilersystem der Kultur aufrechterhält, um verbreitet zu werden. Das heißt, dieser Film ist gedreht in Koproduktion mit dem Fernsehen, das ihn zur Sendung auch abgenommen hat, sich aber beispielsweise verwahrt, einen Dokumentarfilm wie "Viva Portugal!" von Rauch und Schirmbeck zu senden.
Lilienthals Film, ist in Portugal mit Unterstützung der portugiesischen Armee gedreht, Drehbuchautor ist der Exilchilene Antonio Skarmeta, der schon "La Victoria" für Lilienthal schrieb. Spanier, Portugiesen, Franzosen und Argentinier wirken mit. Die portugiesischen Soldaten, so erzählt Lilienthal von den Dreharbeiten, hätten sich zunächst geniert, ein Jahr nach der Selbstbefreiung erneut die Unterdrücker zu spielen. Nach der Szene, in der sie rücksichtslos eine Demonstration auseinandertreiben mußten, hätten sie ihre Landsleute umarmt und sich weinend für den "Vorfall" entschuldigt: das ist genau die Szene, die filmisch, nur in dem Dokumentarfilm von Rauch und Schirmbeck zulässig ist und in einem Spielfilm, bei Strafe der Regelverletzung, keinen Platz findet.
© Karsten Witte. Nachdruck und Vervielfältigung des Textes einschließlich Speicherung und Nutzung auf optischen und elektronischen Datenträgern nur mit Zustimmung des Rechtsnachfolgers.