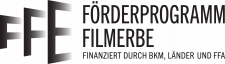Dein unbekannter Bruder
Was kann ein Mensch ertragen?
Beim Sehen dieses Films wird die Erinnerung an E. T. A. Hoffmanns berühmte Erzählung "Des Vetters Eckfenster" wach. (…)
Der Dialog zwischen den beiden Vettern, einer Aufspaltung des dichterischen Ichs, wird zum Essay über das Sehen, über ein Auge, "welches wirklich schaut." Der Dichter definiert sein spezifisches Verhältnis zu dieser geschauten Wirklichkeit.
In Ulrich Weiß" Film gibt auch ein Fenster Auslug auf die Straße. Der Mann, der dahinter steht oder sitzt, hat die naive Lust am Schauen schon längst verloren. Er ist ein Mann, der Angst hat, der täglich mit dieser Angst zu leben hat. Die Angst bleibt nicht draußen, wenn er sein Zimmer betritt. Sie füllt den Raum aus, sickert durch alle Ritzen und Fugen. Sie deformiert sein Sehen. Was ist Wirklichkeit vor dem Fenster, was sind Gespenster und Gesichte eines lastenden Alptraums? Der Mann kann es nicht mehr voneinander trennen. "Irreal" erscheint ihm beides. Eine Hakenkreuzfahne wird immer größer. Sie wächst und wächst. Dann klirrt ein SA-Aufmarsch auf. Die da marschieren, angeführt von einem zwergenhaften Tambour, haben sie überhaupt Gesichter? (…) Auch bei E. T. A. Hoffmann veränderte sich Wirklichkeit. Die Gestalten des "gewöhnlichen Lebens" erscheinen in einem "inneren romantischen Geisterreich". Es waltet das Prinzip des phantastischen Realismus mit romantischem Hintersinn. In der Faschismus-Vision des Films ist eine quälende innere Verfassung nach außen gestülpt. Eine "Seelenlandschaft" wird Bild, und so sichtbar. Vorgänge, Dinge und Menschen werden immer wieder in dieser "Seelenlandschaft" des Arnold Clasen für den Zuschauer präsent. Nur in solcher Korrespondenz können sie begriffen werden, nicht in einer von Arnold Clasen unabhängigen Existenz. Arnold sucht zum Beispiel den kleinen Händler und Pg. Deisen in dessen Wohnung auf. Er sieht einen Affen im Käfig, eine Schildkröte. Der Wohnungsinhaber hat selbst die Lebensformen seines kleinen Tierzoos angenommen. Tier und Mensch: hier wie da die eingesperrte Bewegung, hier wie da das reduzierte Leben. Einmal besuchen Arnold und der Verräter Wolter eine Nachtbar. Die innere Unruhe, die unausgesprochenen Befürchtungen nehmen figürliche Formen an; der Conferencier bekommt die Züge des Verräters. Eine Schlangentänzerin tritt auf. Die Schlange windet sich um den Körper. Arnold Clasen ist umstellt von einer Welt der Zeichen.
Wir sehen mit Arnold Ausschnitte aus zwei Filmen. Das gepflegte Seelendrama des ambitionierten Kommerzes (Erich Waschnecks "Regine") kommentiert auf eigene Weise seine latente Bedrohung. Er ist in einer Situation, in der ihn solche "gehobenen" Dialoge als ungeheuerlich anmuten. Die Bilder aus Leni Riefenstahls "Triumph des Willens"" quälen auf andere Weise: Hat sein Kampf Sinn und Zukunft angesichts dieser verzückten und fanatisiert-gläubigen Menge? Spricht aus diesem Schauspiel des Menschenfängers in Nürnberg nicht die Kraft der historischen Authentizität? Kann Clasen seinen Sinnen vertrauen, oder muß er sie lügen strafen? Man braucht wirkliche Augen, um zu sehen, was es noch nicht gibt. Ulrich Weiß hat – nach Motiven des Romans von Willi Bredel – einen Film über Leben im Faschismus gemacht, der keine Wiederholung früherer thematischer Versuche in unserer Kinematographie ist. Ein anderer individueller Zugang wird gesucht, Fragen einer Generation brechen auf, die den deutschen Faschismus nicht mehr selbst erlebt hat. In einem Gespräch sagte mir Ulrich Weiß:
"Ich frage mich, woraus kommt Stärke, Beharren? Wie kann das so einer tragen, diese Angst, diese Last? Was kann überhaupt ein Mensch ertragen?… Für mich mündet die alltägliche Angst in einer konkreten Zeit in eine existentielle Angst. Dieser Prozeß sollte sichtbar werden." (…)