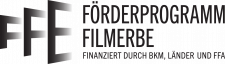Christine
Christine. Ein Fragment von Slatan Dudow
Fred Gehler, Sonntag, Berlin/DDR, 15.12.1974
Die Fakten sind bekannt: Durch einen tödlichen Unfall blieb Slatan Dudows Film, den er mit Leidenschaft und Hingabe liebte, unvollendet. Noch standen Dreharbeiten aus, noch hatte das abgedrehte Material nicht in der Montage seinen Rhythmus, seine erzählerische Struktur erhalten. Dudows eigenwillige Arbeitsweise ("Es dauert lange, wenn es werden soll…,") ließ auch Absichten und Versuche, "Christine" nach seinem Tode zu vollenden, nicht als opportun erscheinen. Es sollte mehr als zehn Jahre dauern, bis es in diesem Jahr im Studio CAMERA in Berlin zu einer "Studioaufführung des unvollendeten Films in teilweise vertonter Rohschnittfassung" (so die Programmankündigung) kam. (Im nächsten Jahr soll "Christine" zum ständigen Programm der Filmkunst-Kinos gehören.)
Es ist eine eigentümliche Sache um Filmtorsi. Denken wir an so berühmte Fragmente wie Eisensteins "Beshin-Lug", Josef von Sternbergs "I-Claudius", Strohheims "Queen Kelly" oder Andrzej Munks "Die Passagierin". Sie sind sicherlich ein höchst fruchtbarer Boden für Legendenbildungen, doch geht von ihnen unzweifelhaft eine eigentümliche Faszination aus. Der Blick in eine schöpferische Werkstatt scheint hier unverstellter, die Bilder scheinen ursprünglicher, direkter. Momente der Entstehung des Films werden unmittelbar sichtbar, bringen zusätzliche Assoziationen. Das hier verallgemeinert Gesagte trifft im Detail auch auf Dudows letzte Arbeit zu. Es erscheint mir allerdings unbillig, daran Mutmaßungen zu knüpfen, die versuchen, den Rang des Fragmentes in der filmpolitischen Landschaft der DEFA zu bestimmen, die weiterreichende ästhetische Schlußfolgerungen daraus ziehen.
Die Begegnung mit Dudows "Christine" ist in anderer Hinsicht kostbar. Sie rundet und formt das Bild einer künstlerischen "Persönlichkeit, die seine Freunde "Dudow, der Kompromißlose" nannten. Eine immer suchende und gleichzeitig zielklare Gestalt, die konsequent bestrebt war, große gesellschaftliche Problematiken in ihrer Verästelung bis hinein in die Familie, in das Individuelle und Private zu verfolgen. Auch in "Christine" beweist Dudow einmal mehr seine genaue Kenntnis der menschlichen "kleinen Revolutionen", die sich infolge einer historischen sozialen Umwälzung vollziehen, seine leidenschaftliche Neugier auf den Alltag, auf seine Widersprüche. Das wechselvolle Schicksal der jungen Landarbeiterin Christine ist das leider letzte Glied einer Filmkette, in der Dudow sich immer wieder der Entwicklung der Frau und der Liebe in unserer Gesellschaft zuwandte – vielleicht war es überhaupt sein Thema. "Frauenschicksale", "Verwirrung der Liebe". Polemik gegen die "Moral" des "man lebt ja nur einmal", die moderne Transformation des Goetheschen Wahlverwandtschaften-Motivs. Immer wieder Versuche, das Schönheitsideal unserer Zeit zu entwerfen, eine Liebe ohne Katastrophen zu schildern. Und immer wieder das Motiv der Mütterlichkeit, des persönlichen Glücks, der Identität Individuum-Gesellschaft. Wie wir wissen, zog Dudow einst in den dreißiger Jahren aus, um Prozesse des Veränderns zu fixieren und die "neue Welt", die die alte ablöst, zu zeigen. Diese Triebkraft eines Schaffens bestimmt voll und ganz Sujet und Moral von "Christine".