Credits
Director
Screenplay
Director of photography
Editing
Production company
Producer
All Credits
Director
Screenplay
Director of photography
Editing
Production company
Producer
Duration:
135 min
Format:
35mm
Video/Audio:
Farbe + s/w, Ton
Screening:
Aufführung (DE): 11.06.2023, Hamburg, Kurzfilm Festival
Titles
- Originaltitel (DD) Frauen in Berlin
Versions
Original
Duration:
135 min
Format:
35mm
Video/Audio:
Farbe + s/w, Ton
Screening:
Aufführung (DE): 11.06.2023, Hamburg, Kurzfilm Festival
Digitalisierte Fassung
Duration:
139 min
Video/Audio:
Farbe + s/w, Ton
Screening:
Aufführung (DE): 30.01.2025 - 09.02.2025, Rotterdam, IFF
Die Digitalisierung dieses Films wurde 2024 im Rahmen des Förderprogramm Filmerbe gefördert.
Das Förderprogramm Filmerbe (FFE) von BKM, den Ländern und FFA stellt seit dem 1. Januar 2019 für den Zeitraum von zehn Jahren jährlich bis zu 10 Millionen Euro für die Digitalisierung von Kinofilmen zur Verfügung.
Für die abendfüllenden Spiel- und Dokumentarfilme in diesem Förderprogramm stellt filmportal.de die jeweiligen Filmanfänge bereit. Eine Übersicht über alle geförderten Filme auf filmportal.de finden Sie hier.
Weitere Informationen unter www.ffa.de
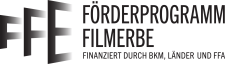
Comments
You have seen this movie? We are looking forward to your comment!
Login or register now to write a comment.
In dem im August und September 1981 entstandenen Interviewfilm „Schattenbilder“, so der Arbeitstitel des Diplomfilms der damals 22-jährigen indischen Regiestudentin Chetna Vora an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg (HFF), sprechen Frauen in frappanter Offenheit über ihr Leben, ihre Arbeit, ihre zumeist gescheiterten Beziehungen. Extreme Lebensläufe sind darunter wie der einer ängstlichen jungen Mutter, die nach einer Vergewaltigung kein Vertrauen mehr fassen kann zu einem Mann. Oder der einer schon älteren Frau, die immer wieder eine Partybekanntschaft, die sich bald als ein verheirateter Familienvater entpuppt, bei sich aufgenommen hat in der letztlich vergeblichen Hoffnung, er werde sich von Frau und Kindern trennen um an ihrer Seite ein neues, glücklicheres Leben zu beginnen.
Meistens sind es alltägliche Geschichten, die in von Männern geprägten Gesellschaften, im Sozialismus wie im Kapitalismus, Typuscharakter beanspruchen können: Sex, Schwangerschaft, alleinerziehende Mutter mit oder ohne familiären Hintergrund durch die eigenen Eltern. Scheidung, Abtreibung – in der DDR, deren völlig ineffiziente Planwirtschaft auf Frauenarbeit angewiesen ist, kein Problem. Weder juristisch noch moralisch. Aber gefühlsmäßig für die Frauen, die gegenüber der zumeist um einiges jüngeren Filmstudentin kein Blatt vor den Mund nehmen. Obwohl sie wissen, dass HFF-Diplomfilme, fernsehgerecht auf zumeist dreißig Minuten geschnitten, vom Fernsehen der DDR ausgestrahlt werden.
Nachdem über Monate ein Vertrauensverhältnis zwischen dem nur dreiköpfigen Filmteam und den potentiell zu befragenden Frauen aufgebaut worden ist, sprechen sie in nie gekannter Offenheit über Versorgungsprobleme, die notdürftig durch die Solidarität des Arbeitskollektivs oder der Hausgemeinschaft gemildert werden können, wenn etwa die Nachbarin für die alleinerziehende Mutter im Konsum Schlange steht, während diese ihr Kind von der Krippe abholt. Thomas Plenerts Kamera ist dabei, wenn sich ein junges Mädchen im Bikini in der Küche die Haare wäscht in Ermangelung eines eigenen Bades, wobei das Wasser für die Schüssel im Kessel auf dem Herd erwärmt werden muss.
Bei der Plandiskussion im Betrieb wird ein Soll vorgegeben, das nicht zur Diskussion steht: eine eigene Meinung ist unerwünscht. Die ganze Veranstaltung daher aus Arbeitersicht sinnlos. Und bei der Besetzung von Führungspositionen werden Frauen erst gar nicht in Betracht gezogen, da sie als Konkurrenten ihrer männlichen Mitbewerber nicht ernst genommen werden. Vom neuen sozialistischen Menschenbild ist hier keine Rede, wohl aber von trotz aller Nackenschläge emanzipierten Frauen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen.
Ihm sei „kein Dokumentarfilm der DDR bekannt, der Emanzipation so umfassend begriffen hat“, schrieb Ulrich Weiß in seinem zweiseitigen Gutachten über den Film „Schattenbilder“, bewertete ihn als „ausgezeichnet“ und fügte noch einen für ein amtliches Schriftstück ungewöhnliches Schlusswort an: „Ich wünsche Chetna Vora Glück.“ Dem Diplomfilm der bald danach in ihre Heimat zurückgekehrten Regisseurin ist solches Glück versagt geblieben: Während der finalen Schnittphase wurde er von der Hochschulleitung aus dem Verkehr gezogen. Das sowohl auf Schwarz-Weiß- wie Farbfilm gedrehte Material ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Überlebt hat eine für das Fernsehen der DDR erstellte Kurzfassung, die mit heutigem Forschungsstand damals nicht ausgestrahlt worden ist.
Und eine vom Kameramann Thomas Plenert und dem Gatten der Regisseurin, Lars Barthel, heimlich erstellte Videoaufnahme der 139-minütigen Rohfassung in zumeist mangelhafter Bild-, aber ausreichender Tonqualität. Die Premiere im September 2018 im Berliner Zeughauskino im Rahmen der Retrospektive „In deutscher Gesellschaft. Passagen-Werke ausländischer Filmemacher 1962 – 1992“ musste aufgrund technischer Probleme abgebrochen werden. Inzwischen ist das VHS-Videomaterial digitalisiert worden und feierte unter dem Titel „Frauen in Berlin“ nach Vorführungen in kleinerem Rahmen u.a. in Frankfurt/Main am 16. März 2019 wiederum im Berliner Zeughauskino seine Uraufführung vor großem Publikum, darunter Thomas Plenert, Lars Barthel und Produzentin Anita Vandenherz.
Pitt Herrmann