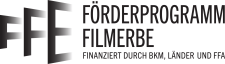Warum läuft Herr R. Amok?
Warum läuft Herr R. Amok?
Leo Schönecker, film-dienst, Nr. 18, 07.09.1971
Herr R. ist technischer Zeichner, verheiratet, ein Kind; hat zumindest vollgenügendes Auskommen, eine baldige Gehaltserhöhung erscheint möglich; er bewohnt eine leidlich hübsche, modisch eingerichtete Wohnung mittleren Komforts und hat materiell keinen Grund zur Klage. Also, in der Tat, kein besonderer Fall. Woran fehlt es? Die Co-Autoren und antiteater-Regisseure Fengler und Faßbinder haben es in kurzen Episoden angedeutet: beim familiären "Gespräch", beim Sonntagsspaziergang mit den Großeltern, bei der väterlichen Lernhilfe, beim Besuch des Schulkameraden, bei der ärztlichen Pflichtkontrolle, bei einer kleinen Betriebsfeier. Sind solche alltäglichen Erlebnisse nicht nennenswert? Soweit dem Zuschauer diese Erfahrungen schon fast selbstverständlich geworden sind, verspürt er durch diese Nachzeichnung den Leerlauf des Durchschnittsmenschen, der Familie, der Arbeit, der Freizeit mit geradezu physischem Unbehagen. Aus nachempfundener Stimmungssituation werden Beweggründe einer angestauten, plötzlich aufbrechenden und nicht mehr kontrollierbaren Aggressionsbereitschaft annähernd verständlich – zumindest bedacht. Herr R. nämlich nimmt einen Kerzenleuchter und erschlägt die (unentwegt von sich selbst quasselnde) Nachbarin, seine Frau, seinen Sohn und erhängt sich am Fensterkreuz des Badezimmers. Wie in jeder dritten trivialen Kinogeschichte. Nicht ganz: Der Film (ein fast "farbloser", stichig bunter Farbfilm) vermag bewußt zu machen, was im Leben des Herrn R. "Besonderes" war – bevor der Amoklauf mit mehrfachem Totschlag endete. Es fehlte an etwas freundlicher Wärme und zwischenpersönlichem Interesse. Man kann es auch Freundschaft nennen, Fähigkeit oder nur etwas Bereitschaft, auf einen anderen hinzuhören, Liebe.
Es mag paradox klingen: ein Film über ein bißchen Glück des Alltags. Niemand kann den Autoren übelnehmen, daß ihr Film nicht wenig böse ist. Er knüpft – insbesondere auch formal – an Faßbinders "Katzelmacher" (fd 16511) an und führt seinen letzten Film, "Götter der Pest" (fd 17132), mit Hilfe des sehr behutsam vorgehenden Co-Autors Fengler weiter, tiefer, so daß dieser Film vom täglichen Amoklauf längst nicht mehr ein leicht konsumierbarer Trivialfilm ist. Die Zuschauer müssen sich hiernach die Frage stellen: Warum laufen nicht die meisten Menschen Amok? Und: Inwieweit tun sie es allerdings doch?
Indem die Autoren das tägliche Leben und geistige Absterben in der Welt des Herrn R. in exemplarischen Ausschnitten (nicht psychologisch entwickelnd), modellhaft und nicht "dokumentarisch", nachzeichnen, stellen sie keine Behauptungen auf, keine Feststellungen eines Verhaltens, das in allem nur immer so sei wie hier dargestellt und nicht anders sein könne. Statt dessen stellt der Film hinter die Darstellung materiellen "Wohlstandes", der einem natürlichen Glücksstreben und Glücklichsein nicht entspricht, ein unübersehbares Fragezeichen: äußerer Wohlstand und gesetztes Wohlverhalten sind nicht sogleich mit persönlichem Erfolg und erst recht nicht mit Glück verbunden oder gar gleichbedeutend, weder objektiv noch subjektiv. Glück ist nur sehr differenziert zu schmieden, weil es für jeden verschieden, nur mehr für die wenigsten noch "das Einfachste" ist, doch für alle immer noch das Besondere und Außergewöhnliche bedeutet. Herr R. (und seine Umwelt) läßt spüren, daß Glück ohne konkrete Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Daseins gerade heute nicht möglich ist. Je mehr es in einer Gesellschaft wie der unseren auf verdinglichte Leistung ankommt und der persönliche "Ausgleich" fehlt, um so tiefgreifender wird der Mensch als kleines Funktionsrädchen im riesigen Apparat an seinem Unvermögen, an der unpersönlichen Hast und an entfremdenden Kontaktstörungen leiden – vielleicht solange, bis er "durchdreht" oder aus der Beklemmung im Affekt sich abreagiert, zurückschlägt wie Herr R., dessen Umwelt sich ihres Mangels und ihrer Verursachung der vernichtenden Aggression niemals bewußt wurde. Auch die familiäre Umgebung des R. geriet immer entfernter, verlorener; sie wurde in gleichem Maße eigenschaftslos wie R. auch in der sterilen Berufsarbeit immer mehr zu einer austauschbaren, verfügbaren Sache geworden war.
Kurt Raab spielt diesen stumpf und seelenlos werdenden Menschen, der noch halbwegs rührend, aber hilflos versucht, ein Vater zu sein, bevor er das gegenseitige Versagen mit einem "unglaublich" irrsinnigen Totschlag besiegelt, in einer so überzeugenden Weise, als sei alles nicht inszeniert, sondern augenblicklich sich ereignende Wirklichkeit. Das Genialische, vielleicht in dieser künstlerisch großartigen "Nachlässigkeit" Unwiederholbare ist dabei die erstaunliche Improvisations- und Andeutungskunst, die sich ausdrückt in knappen, scheinbar unbedeutenden Bildern, Szenen und Dialogen (zu denen es ja eben meistens nicht kommt). So zwangsläufig, wie das tragische Ende heranbricht, so irritiert und betroffen sind doch die meisten Zuschauer des "Spiels", dessen manchmal komische Züge sich ständig vermischen mit ernüchternden Abbildern fast schon erstarrter Wirklichkeit, mit Relikten verkümmernder Sprache, mit Rudimenten gestischer Bewegung, mit vergeblichem Aufglimmen innerer Regung.