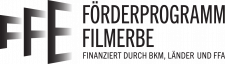Kaspar Hauser
Kaspar Hauser
Rudolf Worschech, epd Film, Nr. 2, Februar 1994
Fünfeinhalb Jahre dauerte das bewußte Leben des Kaspar Hauser. Am Pfingstmontag des Jahres 1828 wird der angstzitternde 16jährige junge Mann, der weder gehen noch sprechen kann, in Nürnberg ausgesetzt. Doch Peter Sehrs Rekonstruktion der Leidensgeschichte des berühmtesten Findlings des 19. Jahrhunderts beginnt nicht erst mit diesem Ereignis, sondern setzt schon kurz nach der Geburt des Knaben ein. Das Schicksal des Babys, das 1812 als Erbprinz des Hauses Baden zur Welt kam, wird bestimmt von einer höfischen Intrige. Wie in einem Prolog führt Sehr in die Machtverhältnisse des Karlsruher Hofes ein, an dem die Gräfin Hochberg zur Sicherung der Erbfolge ihrer eigenen Linie den Säugling beiseite schaffen läßt und gegen das Kind ihres Kammerdieners vertauscht, das durch einen Genickschlag tödlich verletzt wurde und nur noch eine kurze Zeit lebt. "Verbrechen am Seelenleben eines Menschen" lautet der Untertitel des Films, und schon die ersten Bilder zeigen die Brutalität derjenigen, die an den Höfen Politik machen: Das Kind des Kammerdieners wird in eine Hutschachtel gepreßt, und wie bei einer Exekution versetzt ihm ein Höfling unter den sachlichen Anweisungen des Leibarztes den todbringenden Schlag.
Anders etwa als Werner Herzog in seiner Kaspar-Hauser-Verfilmung "Jeder für sich und Gott gegen alle" zeichnet Sehr den dynastischen Kriminalfall minutiös nach. Es ist ein Spiel um die Macht, aus dem die meisten Beteiligten als Verlierer hervorgehen. Und es ist ein Spiel, das mit den Mitteln der Täuschung und Korruption geführt wird. Distanziert und ohne Mitleid für die adligen Beteiligten, die ausgetrickst oder sogar vergiftet werden, blendet "Kaspar Hauser" immer wieder den neuesten Stand des Macht-Pokers ein. Der Film funktioniert auch als Thriller, bei dem der Zuschauer immer mehr weiß als der Protagonist, über dessen Lebensweg die höfischen Machtkonstellationen entscheiden.
Denn der große Verlierer in diesem Spiel ist der Erbprinz. Vier Jahre lebt er auf Anweisung der Gräfin in einem verlassenen Schloß, seine Betreuerin verkauft ihn dann für viel Geld an die mit Baden verfeindeten Bayern, die ihn als Faustpfand 12 Jahre lang in einem finsteren Loch gefangen halten. Erst eine Weisung aus München befreit den mittlerweile 16jährigen aus dem Kerker, und die Konfrontation mit der Welt beginnt. Der Findling wird anstrengenden Verhören unterzogen und im Gefängnis für die Öffentlichkeit ausgestellt. Der Präsident des Nürnberger Appellationsgerichts sorgt dafür, daß Kaspar Hauser bei einem Professor sprechen und schreiben lernt. So wird Hauser zwischen zwei Fronten zerrieben: zwischen den Intrigen der Fürsten und der wohlmeinenden humanistischen Biedermeierei des Professors, der mit Hauser zwar obskure wissenschaftliche Experimente anstellt, ihm aber im Alltagsleben nicht recht zu helfen weiß.
Vor allem aber ist der Professor nicht in der Lage, die Vaterrolle zu spielen. Die projiziert Kaspar auf einen britischen Lord, der ihn angeblich adoptieren und nach England mitnehmen will. Es sind aber nicht nur die Verheißungen eines luxuriösen Lebens, die Kaspar Hauser zusehends dem Professor entfremden, sondern auch immer manifester werdende homoerotische Schwingungen im Verhältnis zwischen dem älteren Lord und dem jungen Mann. Schon Peter Sehrs erster Spielfilm "Das serbische Mädchen", in dem eine junge Jugoslawin ihre Urlaubsliebe in einem winterlich-kalten Hamburg sucht, handelte von einem Zuviel an Gefühl, und auch "Kaspar Hauser" weitet sich fast zum Melodram aus, in dem Gefühle getäuscht und in die Irre geleitet werden. Denn der Lord steht in den Diensten der neuen badischen Regentin. "Liebe ist das beste Messer. Immer trifft sie mitten ins Herz", sagt er einmal. Mit der Figur des Lord verzahnt Sehr auch die die "äußere", politische Handlung mit dem "inneren" Drama, mit der Initiation in die Welt und dem psychologischen Aspekt der Suche nach Identität. So korrespondiert die emotionale Tragik des Kaspar Hauser auch mit dem Komplott gegen ihn: Er verliert durch Gift seinen Mentor, den Gerichtspräsidenten, und wird schließlich selbst von einem machthungrigen Höfling erstochen.
"Kaspar Hauser", die auf 137 Minuten gekürzte Kinoversion einer über dreistündigen Fernsehproduktion, ist ein düsterer Film. Er führt die absolutistische Gesellschaft an einem Endpunkt und als Selbstzweck vor und setzt wenig Hoffnung auf die neue, bürgerliche Klasse, die sich durch ihre Muffigkeit selbst diskreditiert. Sechs Millionen Mark hat die Produktion von "Kaspar Hauser gekostet", und herausgekommen ist ein Film, der neben einer sorgfältigen Inszenierung zwei weitere große Pluspunkte hat: den Hauptdarsteller André Eisermann und die Kameraarbeit von Gernot Roll. Dem Berliner Schauspieler gelingt das Kunststück, nicht nur die verschiedenen Phasen der "Zivilisierung" des Findlings in den Wandlungen seiner Gesichtszüge und Gesten festzuhalten, sondern er schafft es auch, die Widersprüchlichkeiten einer Figur zu zeigen, die nicht nur Opfer ist, sondern auch auftrumpfen und eitel sein kann. Die Ausleuchtung und Kadrierung dieses Films gelungen zu nennen, wäre eine Untertreibung. Die Bilder sind gleichzeitig realistisch und stilisiert. Es gibt eine ausgeprägte Hell/Dunkel-Ästhetik, die mit der dramaturgischen Zweiteilung des Films korrespondiert. Die Innenräume wirken, als wären sie nur von Kerzen ausgeleuchtet und schimmern in einem diffusen Gelb, in das flackerndes Tageslicht einbricht. Gernot Roll scheut nicht davor zurück, Gesichter so hart zu beleuchten, daß die Gesichtszüge fast verschwinden und wie Masken scheinen; manchmal hebt er sie auch wie Lichtpunkte aus dem Dunkel hervor. Selbst die Außenszenen wirken wie romantische Stilleben. Einen solchen Mut zu optischer Opulenz hat man lange nicht gesehen im deutschen Film.